Wolff Heintschel von Heinegg Bücher
12. Februar 1957

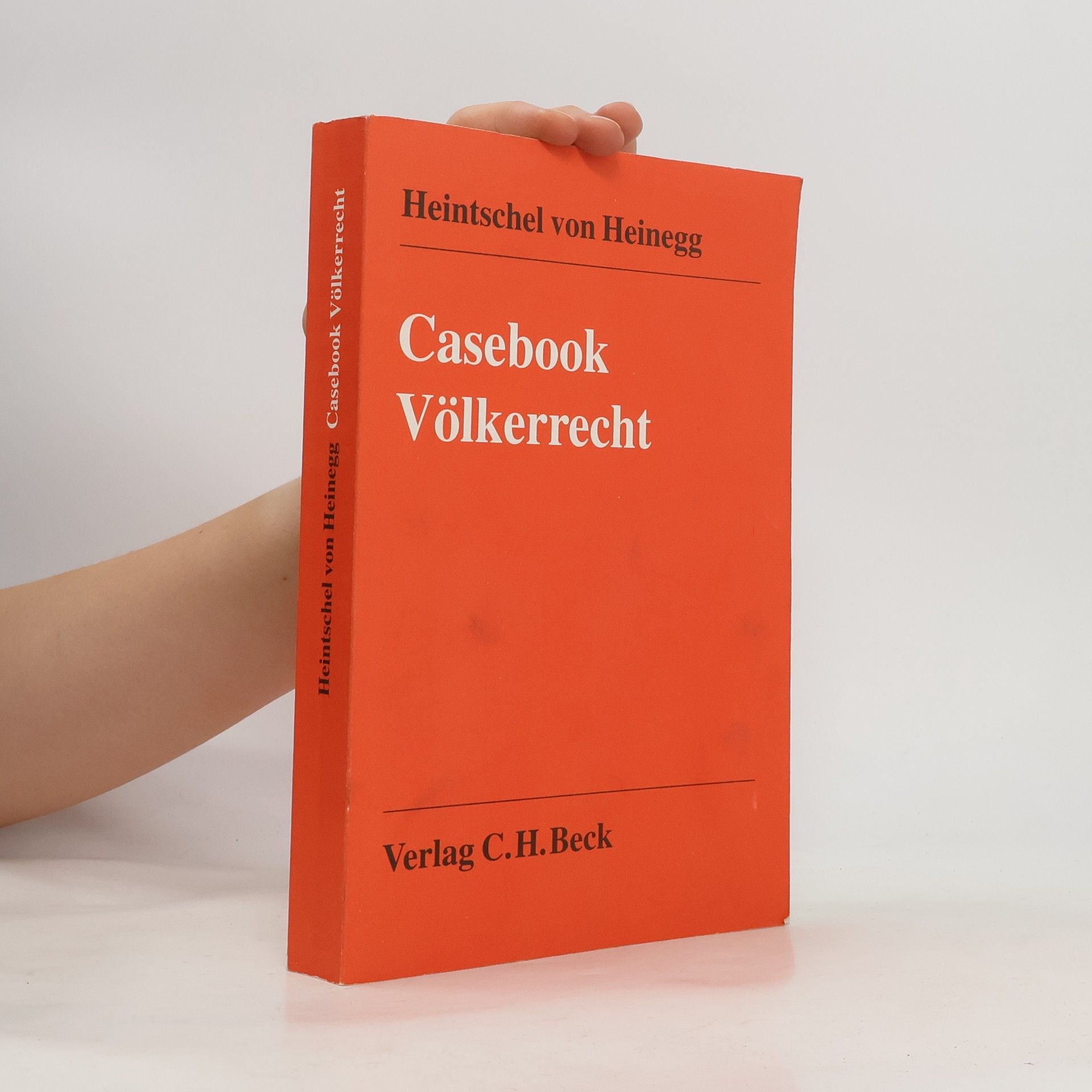
Nuclear Weapons Law
- 246 Seiten
- 9 Lesestunden
Focusing on the legal framework surrounding nuclear weapons, the book systematically explores topics such as sovereignty, the use of force, and war crimes. It offers insights into the responsibilities of submarine commanders and assesses the significance of the ICJ's Nuclear Advisory Opinion and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Written in an accessible style, it serves as a resource for lawyers, military commanders, politicians, and academics, aiming to clarify legal implications and provide practical guidance in this critical field. Open access is also available.