Lutherjahrbuch 92. Jahrgang 2025
Organ der internationalen Lutherforschung
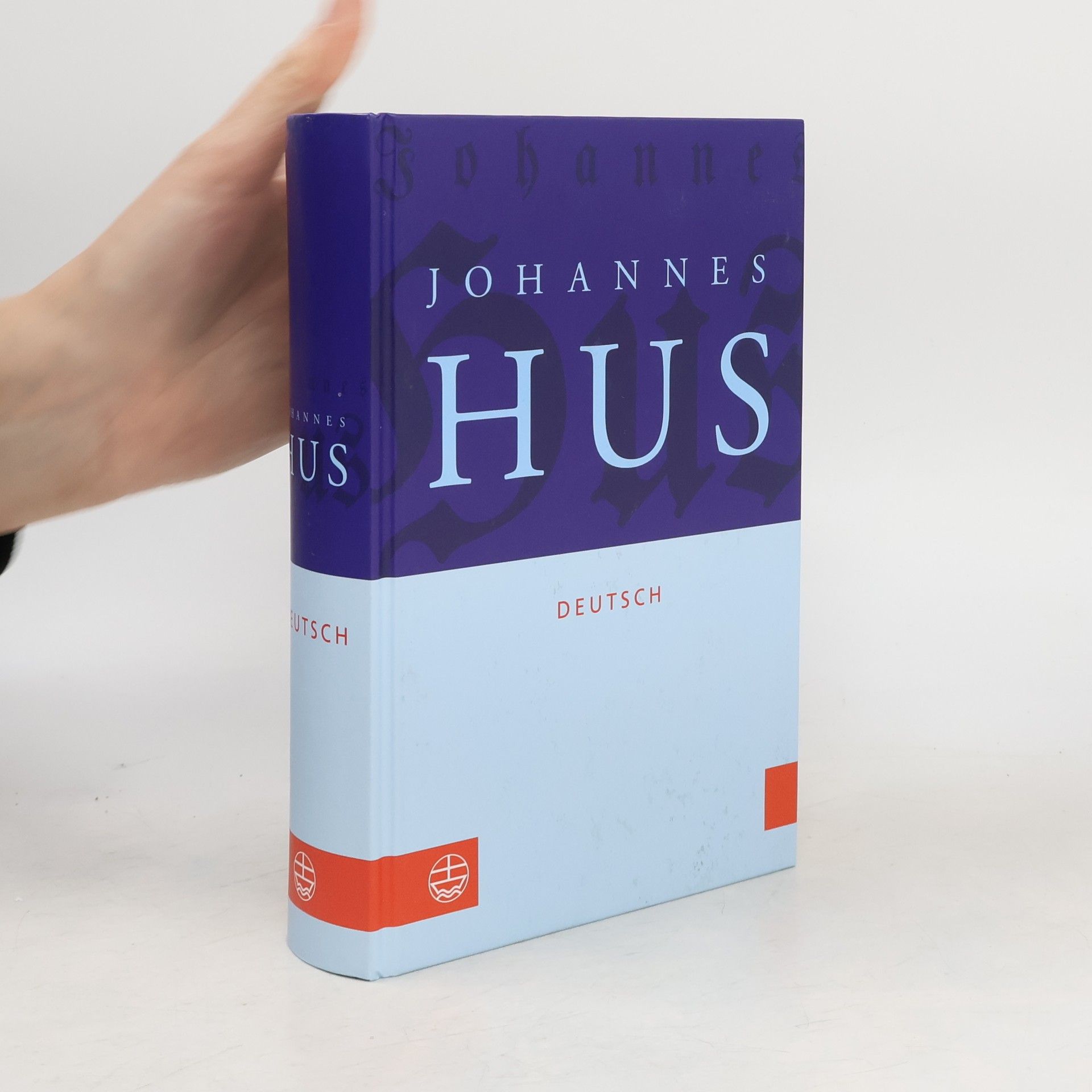
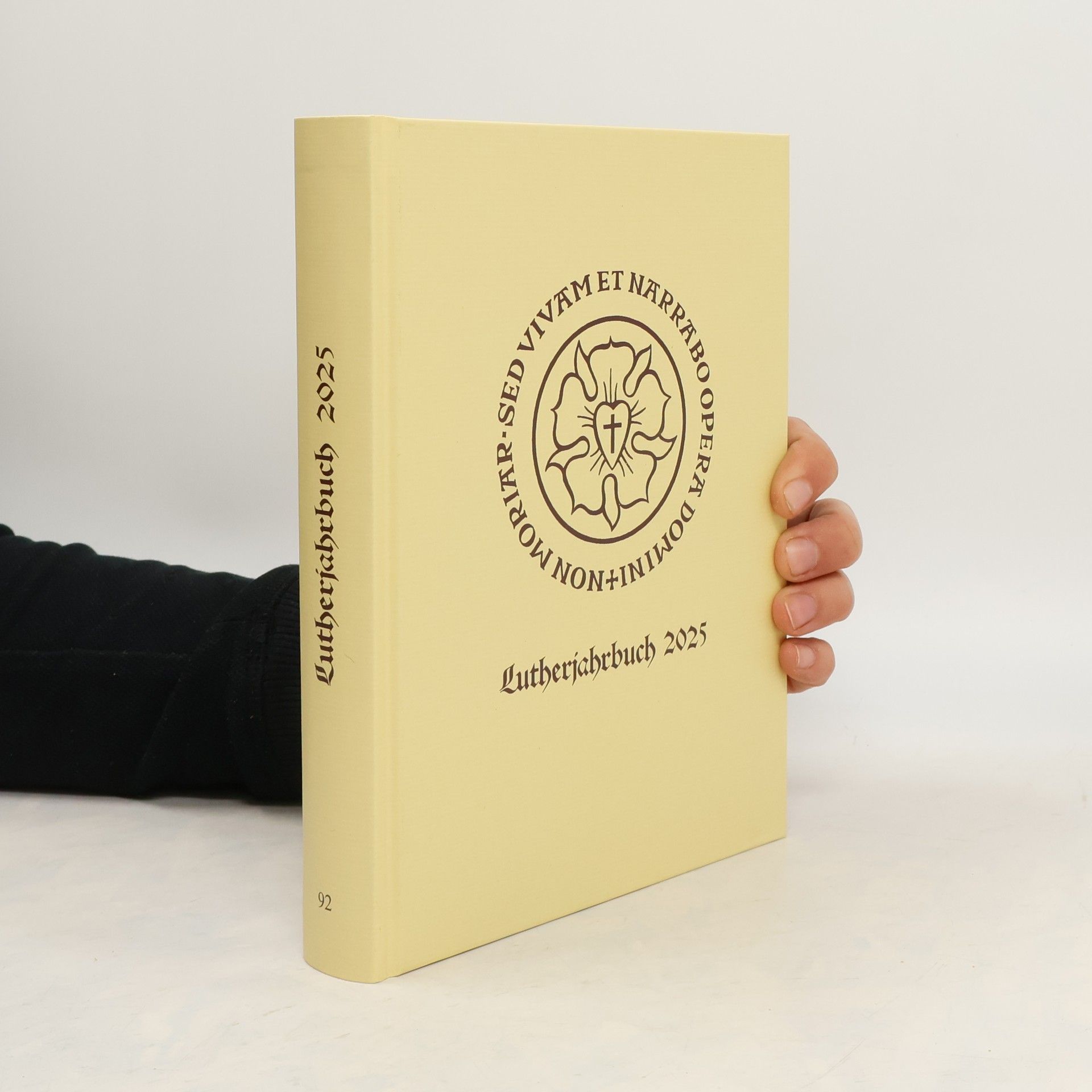


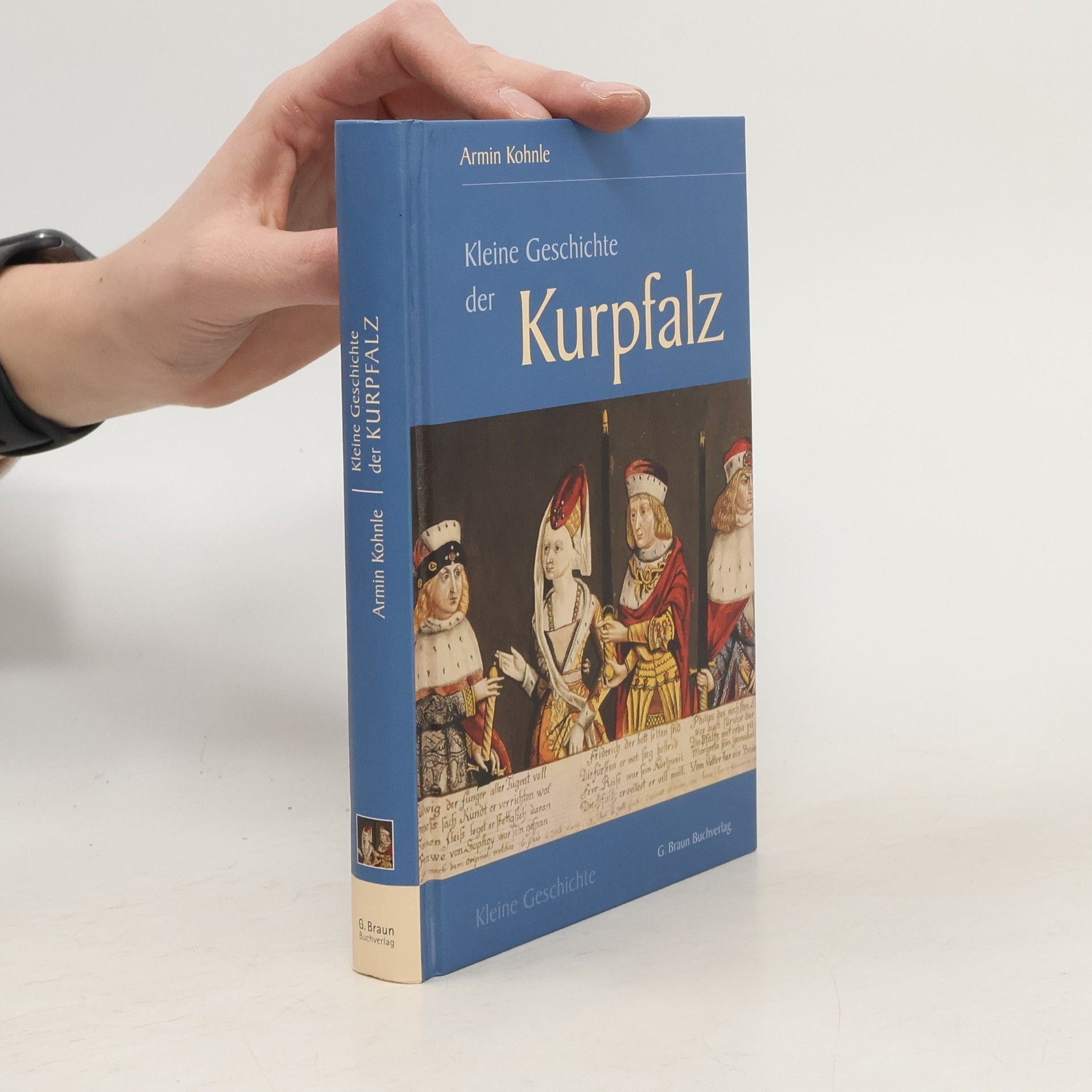
Organ der internationalen Lutherforschung
Der Kurfürst Friedrich III. von Sachsen wird als eine zentrale Figur der deutschen Geschichte dargestellt, die sich durch ihren unermüdlichen Einsatz für Reich, Territorium und Kirche auszeichnet. Die Biografie beleuchtet seine politischen Strategien, die Rolle in der Reformation sowie seinen Einfluss auf die sächsische und deutsche Geschichte. Besonderes Augenmerk liegt auf seinen Beziehungen zu anderen Mächten und der Entwicklung seiner territorialen Ansprüche. Das Werk bietet einen tiefen Einblick in die Herausforderungen und Errungenschaften eines bedeutenden Herrschers des späten Mittelalters.
Quellen und Forschungen zur Kirchenpolitik Kurfürst Friedrichs und Herzog Johanns von Sachsen um 1520
Der Band prasentiert in sechs Beitragen Forschungsergebnisse aus dem Umfeld des an der Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig angesiedelten Editionsprojekts "Briefe und Akten zur Kirchenpolitik Friedrichs des Weisen und Johanns des Bestandigen 1513 bis 1532. Reformation im Kontext fruhneuzeitlicher Staatswerdung". Die Studien beleuchten das Zusammenspiel von Furstenherrschaft und Fruhreformation. Der Blick richtet sich auf das Delikt der Gotteslasterung, die Leipziger Disputation von 1519, die ersten Klosteraustritte und das Verhaltnis der Fursten zu den Bischofen von Meissen und Merseburg. Zudem werden Moglichkeiten und Grenzen einer Edition mit digitalen Hilfsmitteln aufgezeigt. Auf der Grundlage vieler bisher kaum bekannter Quellen bietet der Band neue Erkenntnisse, welche die Reformationsforschung bereichern.
On 6 July 1415, in Constance, Jan Hus was burnt at the stake for heresy. 600 years after this event, this edition of his writings, sermons and letters is intended to remind of the Prague Magister. For the German public the works of Jan Hus in Latin and Old Czech are difficult to access. Therefore the present edition presents a selection of important texts by Hus from 1403 to 1415 in a new German translation. Hus's main work "The Church" is available for the first time in a complete German translation. Introductions and texts will enable the reader to inform himself on the biography, the theological thinking and the trial against Hus before and during the Council of Constance by means of documents written predominantly by Jan Hus himself.
Armin Kohnle zeigt, dass Geschichte spannend und interessant sein kann. In diesem Buch wird eine wissenschaftlich fundierte und gut lesbare Einführung in die Geschichte der Kurpfalz geboten. Die Erzählung beginnt im Frühmittelalter mit der Einführung des „Pfalzgrafenamtes“ und verfolgt die Entwicklung bis zum Ende 1803. Im 12. Jahrhundert kristallisiert sich der geographische Raum der Kurpfalz heraus, und ab dem 13. Jahrhundert gibt es eine kontinuierliche Herrscherfolge. Die Geschichte ist geprägt von Umbrüchen, besonders durch große Kriege, die das Territorium stark beeinflussten. Der Landshuter Erbfolgekrieg, der Dreißigjährige Krieg, der Pfälzische Erbfolgekrieg und die Revolutionskriege führten zu Zerstörung, einer dezimierten Bevölkerung und ruinösen Staatsfinanzen. Zudem erlebte die Kurpfalz im 16. und 17. Jahrhundert konfessionelle Umbrüche, einschließlich eines sechsmaligen Wechsels des Konfessionsstatus im 16. Jahrhundert und weiterer Zäsuren während des Dreißigjährigen Krieges sowie einer Rekatholisierung nach dem Dynastiewechsel von 1685. 1803 endet die Geschichte der Kurpfalz, und ihr Territorium ist heute auf mehrere Bundesländer verteilt. Ein lebendiger Überblick, der für historisch und landeskundlich Interessierte unverzichtbar ist.