André Holenstein Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
5. Juli 1959
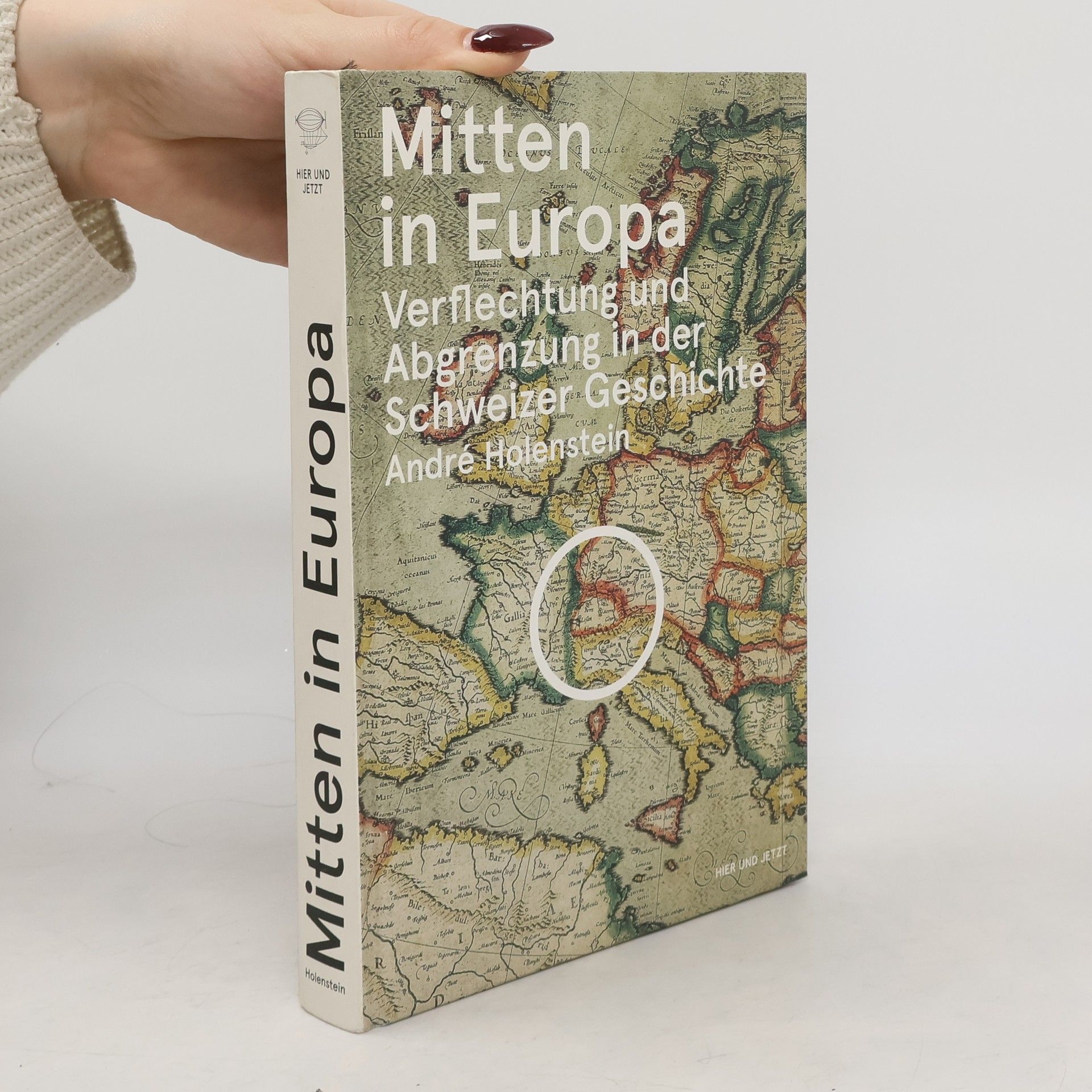

Schweizer Geschichte ist transnationale Geschichte. Es ist die Geschichte eines Raums, der sich im Austausch und in steter Auseinandersetzung mit seinen europäischen Nachbarn nach und nach als Staat territorial abgrenzte und sich seiner besonderen Identität sowie seiner engen Grenzen bewusst wurde. Die Existenz der Schweiz gründet in ihrer besonderen Lage in Europa, sie ist die Resultante europäischer Kräfte und Konstellationen.