Mit der philosophischen Tradition ist María Zambrano bestens vertraut, von Platon bis Nietzsche, von Aristoteles bis Heidegger. Sie selbst nimmt seinen Platz am Rand ein, um von dort aus zu wirken und zu verschieben. Sie ist eine moderne Mystikerin, die die abendländische Tradition des Denkens verwandelt: Unverkennbar sind in ihrem Schreiben die Einflüsse von Teresa de Ávila, Luis de Léon, Johannes vom Kreuz. Aus ihren sich widerstrebenden Interessen der Philosophie, Literatur und Mystik entwickelt Zambrano eine »razón poética«: die das Logische mit dem Poetischen, das Dichten mit dem Denken verwebt. Denkend zu leben und lebendig zu denken – das führt María Zambrano mit inspirierender Leichtigkeit vor. In den Waldlichtungen hat ihre Denkprosa den dichtesten und intensivsten Ausdruck gefunden.
María Zambrano Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
Diese spanische Essayistin und Philosophin war eine Schlüsselfigur des spanischen Denkens im 20. Jahrhundert, die sich auf die Suche nach moralischen Prinzipien und Verhaltensformen für alltägliche Probleme konzentrierte. Ihre Arbeiten befassten sich mit mystischen Überlegungen, ethischen Konflikten und der tiefgreifenden Wechselbeziehung zwischen Realität und Wahrheit, wobei sie einen tiefen Dialog zwischen dem Sein und seiner Umwelt forderte. Sie entwickelte drei Denkweisen: die alltägliche, die vermittelnde und die poetische, wobei letztere den Zugang zum Heiligen und Transzendenten ermöglichte. Ihr Vermächtnis liegt in der Verbindung von Philosophie, Poesie und existentieller Forschung.
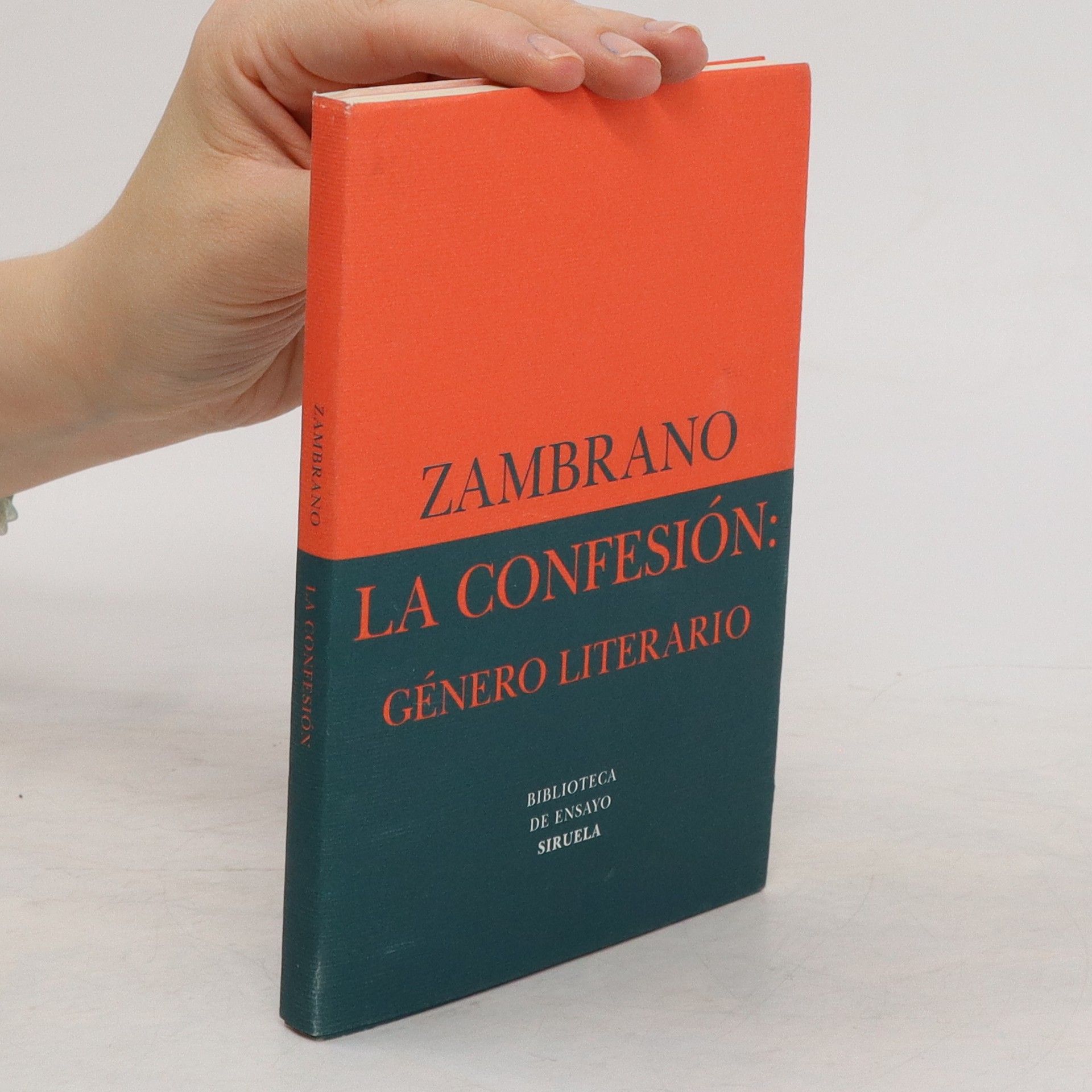
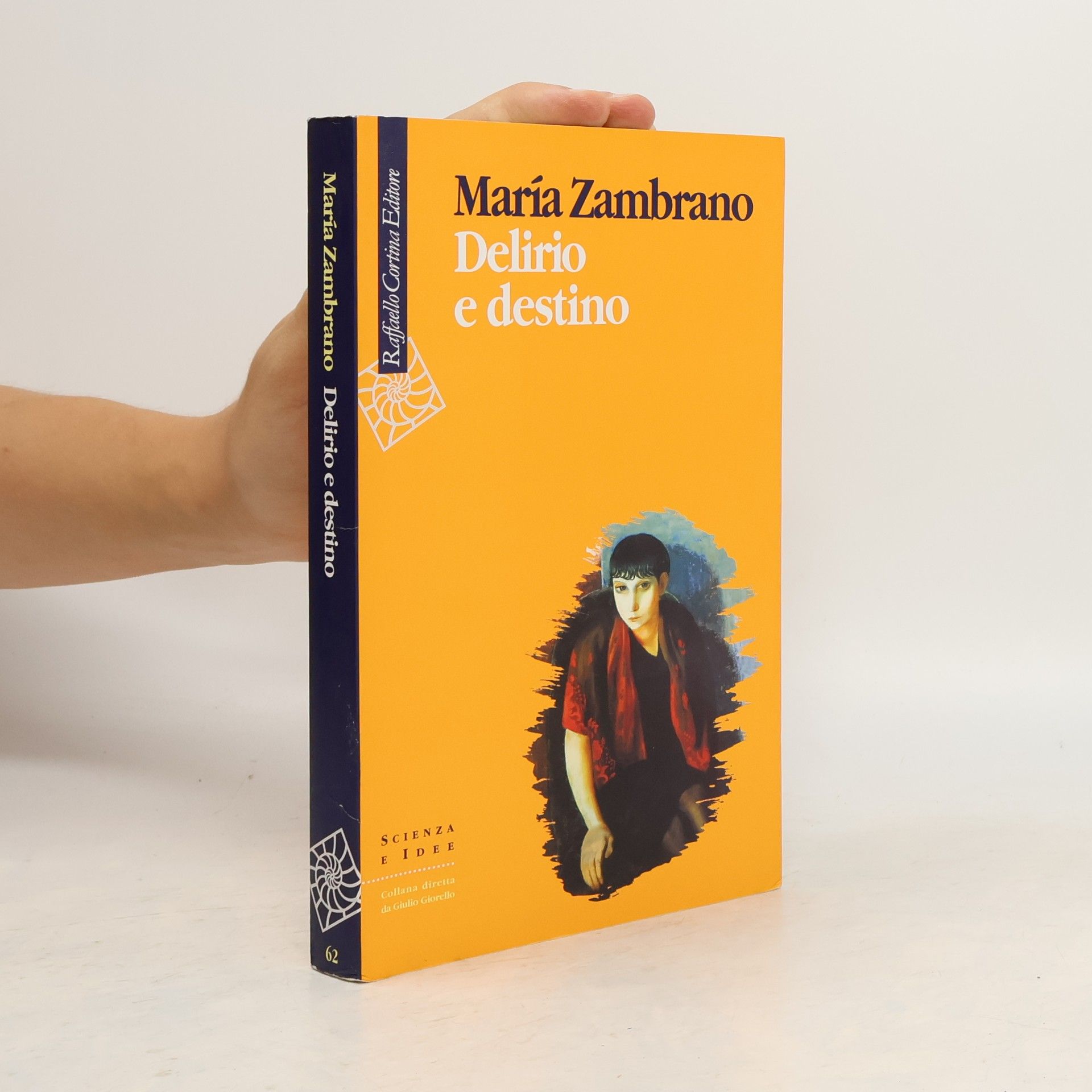


Delirio e destino
- 322 Seiten
- 12 Lesestunden
Attraverso il filo conduttore autobiografico, Maria Zambrano narra gli eventi vissuti in Spagna tra il 1928 e la fine del 1948: l'infanzia, gli anni universitari, il fermento intellettuale e le speranze seguiti alla fine della dittatura di Primo de Rivera, l'avvento della seconda repubblica spagnola e l'inizio della guerra civile e del lungo esilio. Un'autobiografia e insieme una confessione personale, storia di un popolo, filosofia tragica e sociologia poetica: alla ricerca della propria anima. Contro qualsiasi no alla vita, Zambrano si affida alla sottile ironia del pensiero, unica mediazione possibile tra mondo dell'oscuro e luce della ragione, tra necessità e libertà, tra essere e non essere.
La confesión
- 108 Seiten
- 4 Lesestunden
«¿Cómo salvar la distancia, cómo lograr que vida y verdad se entiendan, dejando la vida el espacio para la verdad y entrando la verdad en la misma vida, transformándola hasta donde sea preciso sin humillación? El extraño género literario llamado Confesión se ha esforzado por mostrar el camino en que la vida se acerca a la verdad ;saliendo de sí sin ser notada;. [...] La confesión, en este sentido, sería un género de crisis que no se hace necesaria cuando la vida y la verdad han estado acordadas. Mas en cuanto surge la distancia, la menor divergencia, se hace preciso nuevamente. Y por eso San Agustín inauguró el género con tanto esplendor; porque es el hombre viejo desamparado y ofendido, tanto como pueda estarlo el moderno, que al fin, se amiga con la verdad.» A través de autores como Platón, Spinoza, Nietzsche, Kierkegaard, Rousseau, San Agustín o Anacreonte y de textos como el Libro de los muertos, El libro de Job, Crítica de la Razón Práctica o el Segundo Manifiesto del Surrealismo, María Zambrano hace uno de los estudios más importantes sobre la Confesión como género literario en sí mismo y como región límite, invadida e invasora, de los espacios de la Filosofía, la Poesía y la Novela. Esta edición recoge y aporta, por primera vez, las correcciones manuscritas que María Zambrano hizo en el año 1965 a su propio texto, publicado en México en 1943.
Sevilla. 19 cm. 245 p. Encuadernación en tapa blanda de editorial ilustrada. Colección 'Biblioteca de la cultura andaluza', numero coleccion(8). Zambrano, María 1904-1991. María Zambrano Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, José. 1883-1955 .. Este libro es de segunda mano y tiene o puede tener marcas y señales de su anterior propietario. 8475870112