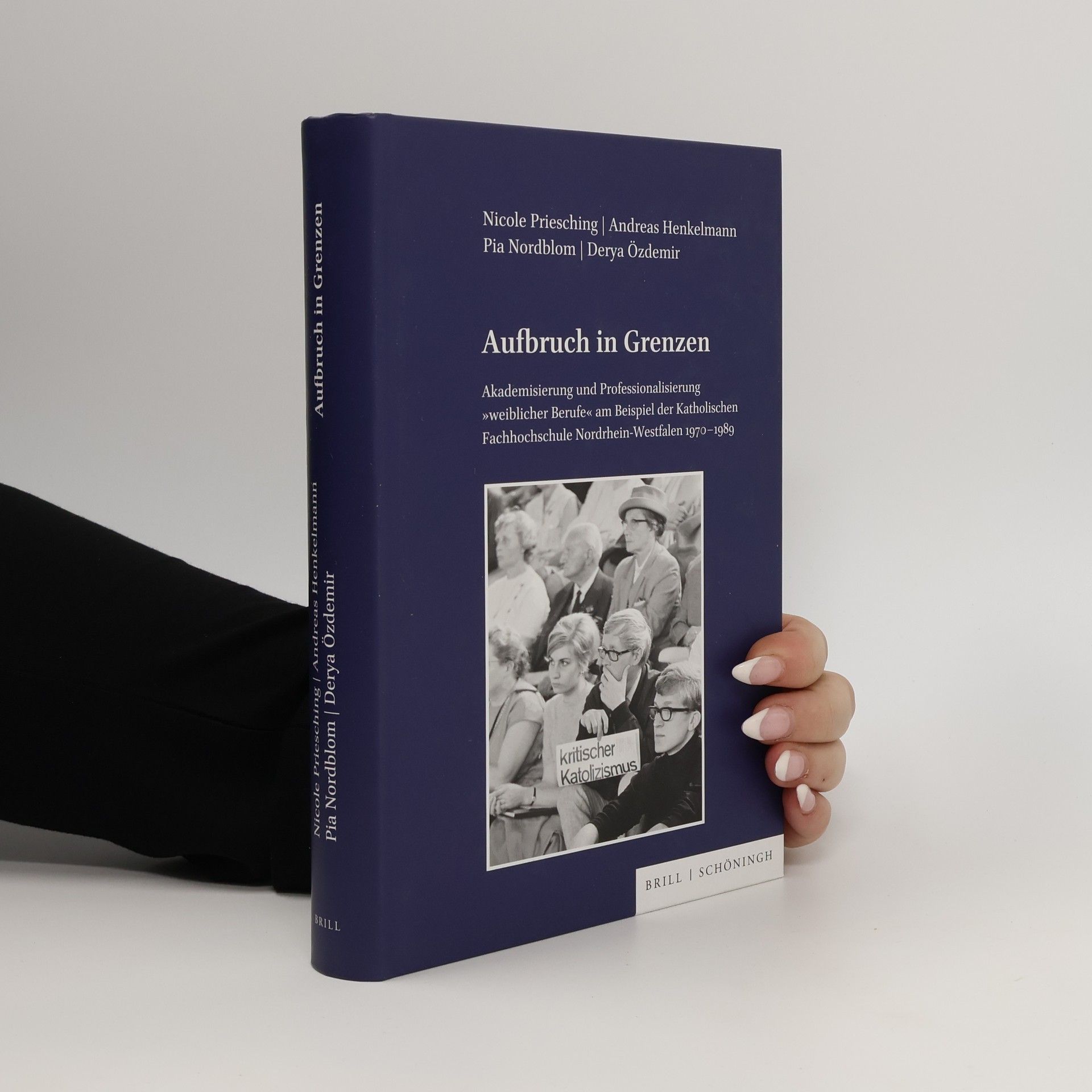Aufbruch in Grenzen
Akademisierung und Professionalisierung weiblicher Berufe am Beispiel der Katholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen 1970-1989
- 402 Seiten
- 15 Lesestunden
Von der Mütterlichkeit zur Partnerschaft, von der Berufung zum Beruf, von der Helferin zur akademischen Fachkraft - den Wandel katholischer Frauenleben von den 1960er- bis zu den 1980er-Jahren untersucht dieser Band. Wie positionieren sich katholische Frauen zwischen Kirche und gesellschaftlichen Entwicklungen? Welche Gestaltungsmacht entwickelten sie und welche Begrenzungen akzeptierten sie? Der Band analysiert erstens das weibliche Rollen- und Berufsverständnis von katholischen Frauen anhand der Zeitschrift "Die christliche Frau", zweitens den Übergang des Berufs der Seelsorgehelferin zu dem der Gemeindeassistentin/-referentin, drittens die Praxis der theologischen Ausbildung von Frauen zu Gemeindereferentinnen sowie viertens die Erschließung des Hochschulraums der Sozialen Arbeit durch Frauen. Das Untersuchungsfeld der Studien bildet die 1971 gegründete Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen.