Verfassungsrechtliche Entscheidungsbegründungen - Rahmenbedingungen, Anforderungen und Auswirkungen Das „Argument der letzten Instanz“ - hier verstanden als Begründung verfassungsgerichtlicher Entscheidungen - ist essenziell: Es unterliegt keiner weiteren instanzenförmigen Kontrolle, soll die Entscheidung nach außen legitimieren, Transparenz schaffen und die juristische Qualität des Verfassungsgerichts unter Beweis stellen. Nach einer verfassungstheoretischen Betrachtung der verschiedenen Zwecke der verfassungsgerichtlichen Entscheidungsbegründungen untersucht die Monografie die positivrechtlichen Rahmenbedingungen, denen der österreichische Verfassungsgerichtshof bei der Formulierung seiner Entscheidungsbegründungen unterliegt. Ebenfalls werden am Beispiel der Asyljudikatur die einschlägigen Anforderungen beleuchtet, die er selbst an andere Gerichte richtet. Ein umfangreicher Abschnitt widmet sich der empirischen Analyse von Aufbau, Umfang, Sprache, Stil und strategischer Argumentationsführung des Verfassungsgerichtshofs über das vergangene Jahrhundert. Abschließend werden die rechtliche Bindungswirkung, aber auch sonstige Auswirkungen der Entscheidungsbegründungen auf Politik, Staat, Wissenschaft und Gesellschaft diskutiert.
Anna Gamper Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
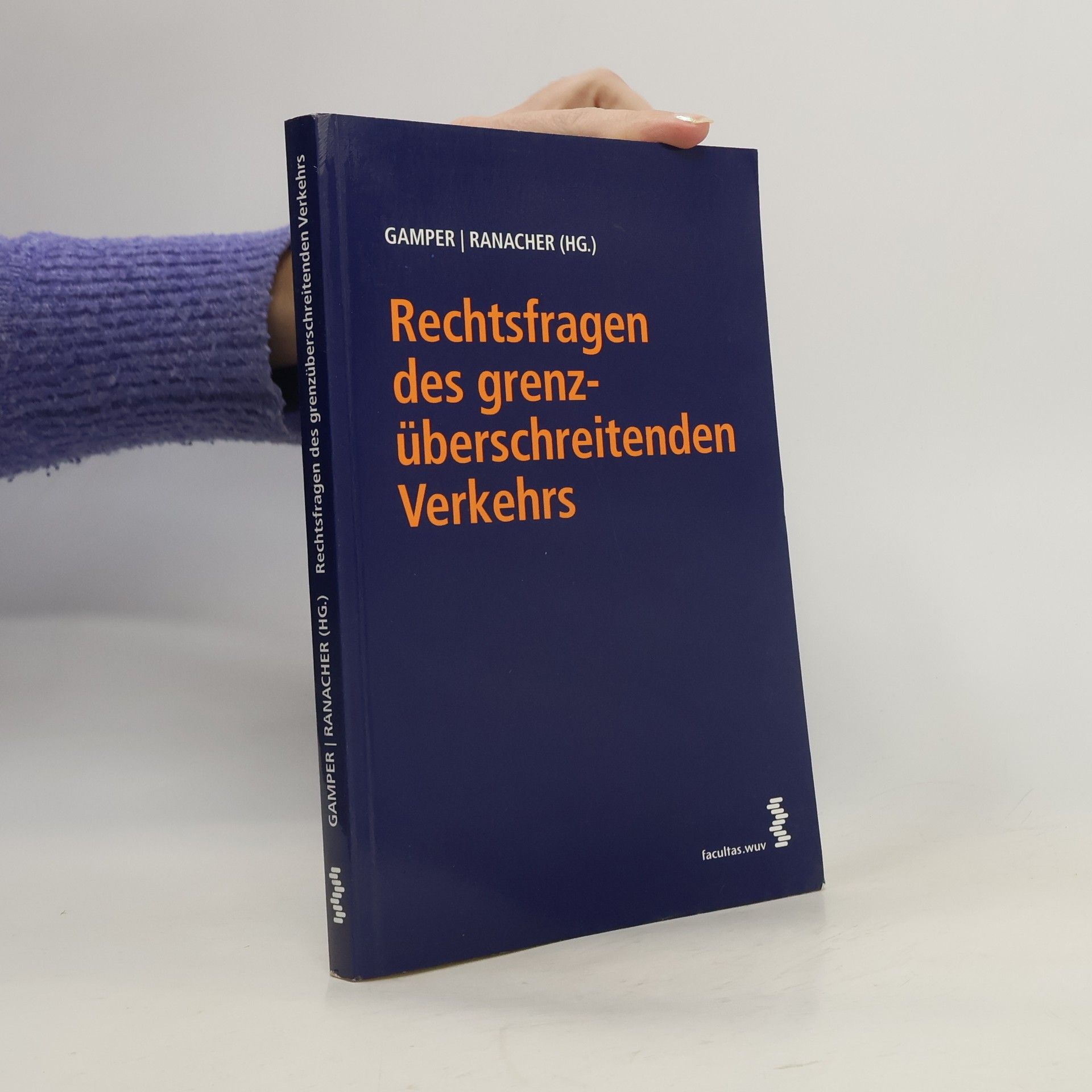



Das kompakte Lehrbuch bringt die theoretischen Erkenntnisse der Allgemeinen Staatslehre einschließlich der Verfassungslehre auf den neuesten Stand und bereichert sie mit anschaulichen Beispielen aus der Verfassungsvergleichung. Die Darstellung widmet sich insbesondere der Definition und Typologie von Verfassungen und (Verfassungs-)Staaten, dem Verhältnis von Gesellschaft und Staat, den Staatszwecken, den Staats- und Regierungsformen, den Modellen der Staatsorganisation, der Demokratie, der Gewaltenteilung, der Rechtsstaatlichkeit sowie den Grundrechten. Durch die Erläuterung der vielfältigen Zusammenhänge von Staat und Verfassung soll die Welt des Verfassungsstaates in ihren heutigen Grundlagen und konkreten Erscheinungsformen erschlossen werden.
Rechtsfragen des grenzüberschreitenden Verkehrs
- 204 Seiten
- 8 Lesestunden
Staat und Verfassung
- 281 Seiten
- 10 Lesestunden
Das kompakte Lehrbuch bringt die theoretischen Erkenntnisse der Allgemeinen Staatslehre einschließlich der Verfassungslehre auf den neuesten Stand und bereichert sie mit anschaulichen Beispielen aus der Verfassungsvergleichung. Die Darstellung widmet sich insbesondere der Typologie von Verfassungen und (Verfassungs-)Staaten, dem Verhältnis von Gesellschaft und Staat, den Staatszwecken, den Staats- und Regierungsformen, den Modellen der Staatsorganisation, der Gewaltenteilung, der Rechtsstaatlichkeit sowie den Grundrechten. Durch die Erläuterung der Wechselwirkungen zwischen Entwicklungsgeschichte und Theorie soll die Welt des Verfassungsstaates in ihren heutigen Grundlagen und konkreten Erscheinungsformen erschlossen werden.