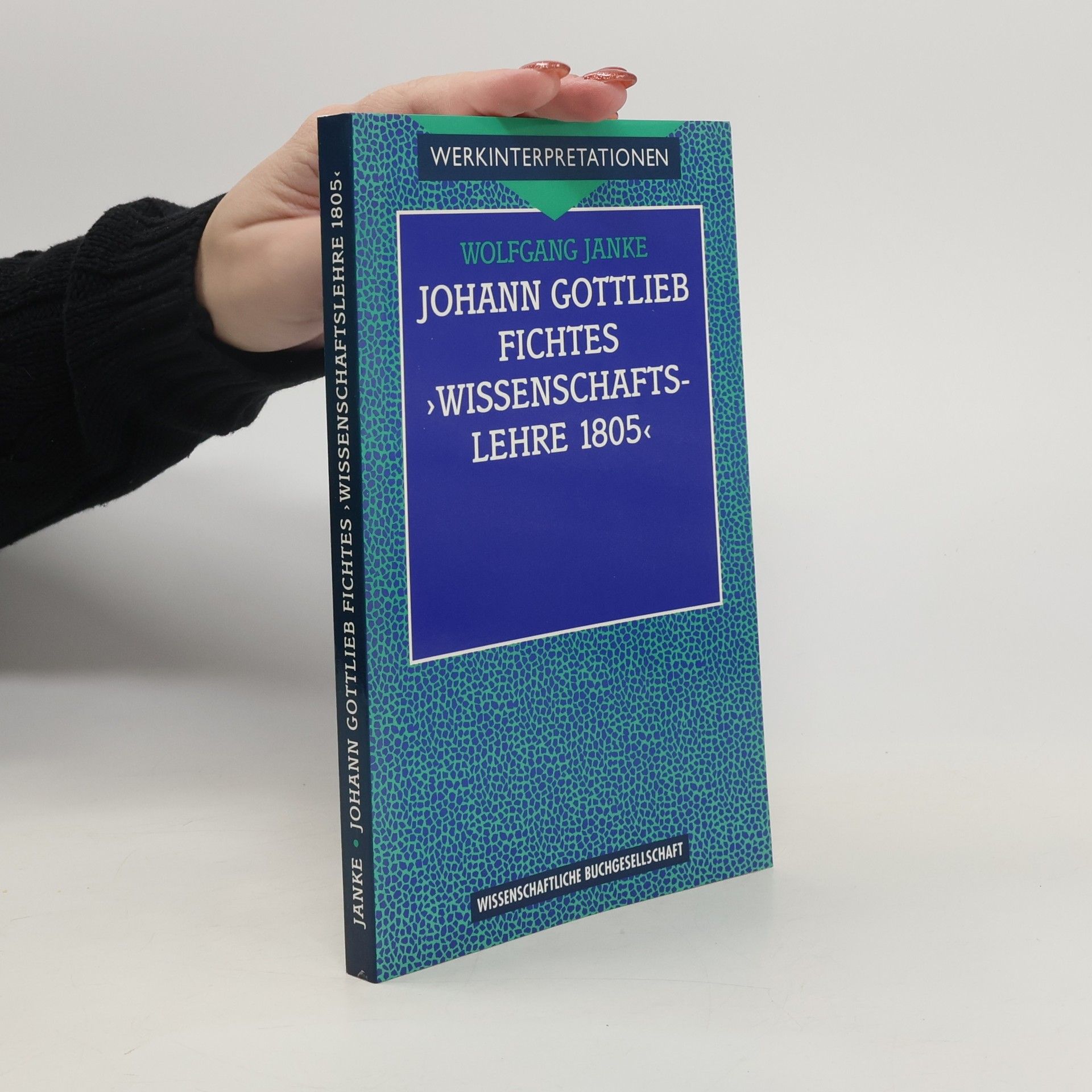Das Glück der Sterblichen
- 288 Seiten
- 11 Lesestunden
Das Buch behandelt ein traditionsreiches und aktuell diskutiertes Thema der Philosophie und Ethik: die Frage nach dem Glück. Der Autor verbindet Philosophiegeschichte mit systematischen Aspekten und stellt die Hauptgestalten der abendländischen Glückstheorie vor. Er thematisiert die menschliche Lage zwischen Glück und Unglück und verknüpft die Frage nach Eudämonie mit sittlich schönem Handeln, Tugend, Lust, Pflicht, Zufall, Schicksal, Spiel und Ernst sowie Muße und Theorie. Ein zentrales Thema ist die Verbindung von Glück, Sterblichkeit und Liebe. Der Erfolg des Lebens hängt davon ab, wie der Mensch den Tod annimmt und die Liebe erfährt. Der Autor möchte Aspekte eines geglückten Lebens, die in der Philosophiegeschichte oft ausgeblendet wurden, wieder in den Fokus rücken – insbesondere die Lebensmächte von Zufall, Notwendigkeit, Liebe und Tod – und diese mit den Prinzipien der Ethik von Lebensernst, Tugend und Pflicht vereinen. Aus dieser Perspektive kommen Philosophen von Aristoteles bis Nietzsche sowie Vertreter des mythischen und dichterischen Denkens zu Wort. Der Leser erhält so einen Überblick über die vielfältige Tradition und den aktuellen Stand der Diskussion über Glück als Sinn und Erfüllung unseres sterblichen Lebens.