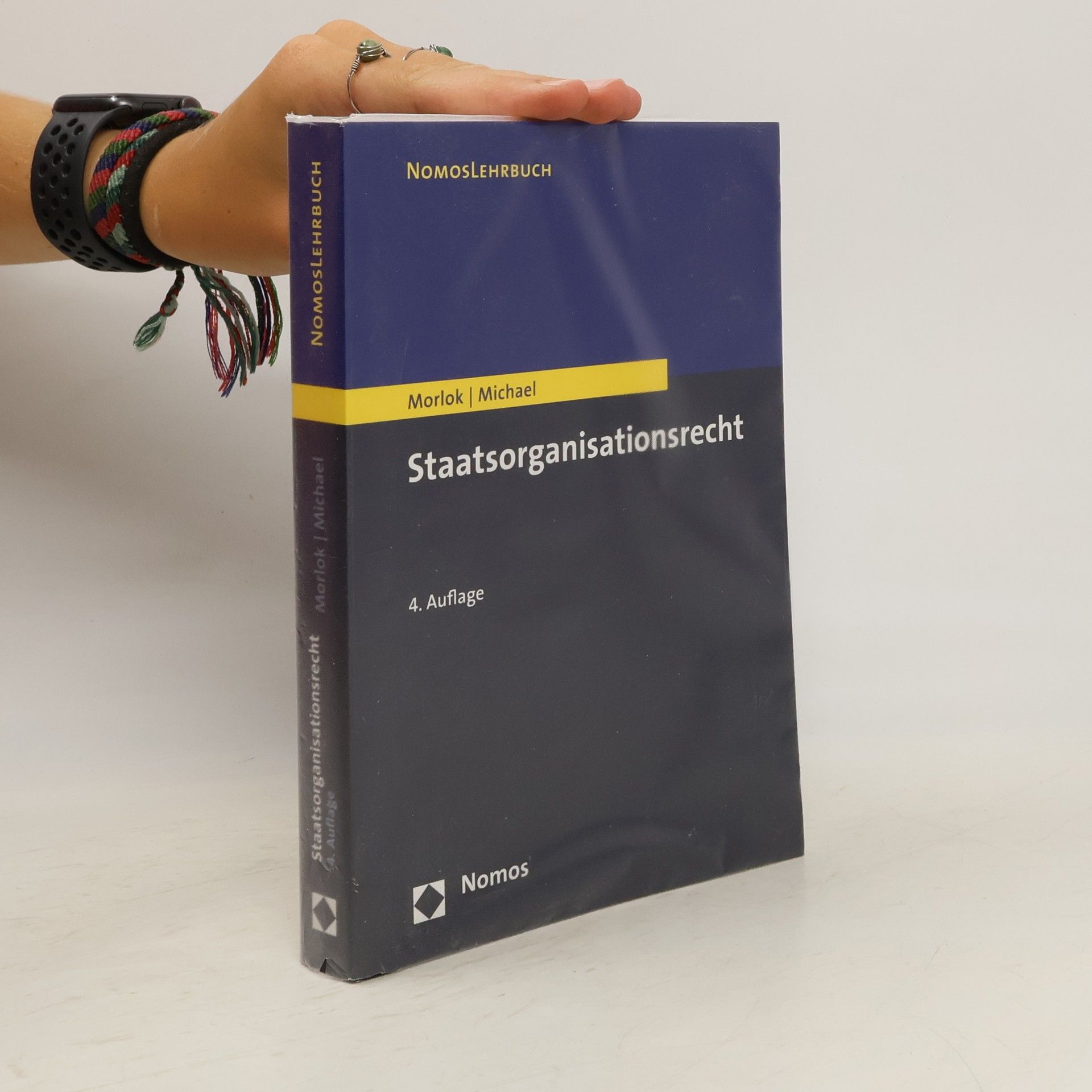Staatsorganisationsrecht
- 400 Seiten
- 14 Lesestunden
Das Staatsorganisationsrecht zahlt bei Studierenden zu den unbeliebtesten Materien des Offentlichen Rechts. Die Schwierigkeiten im Umgang mit staatsorganisatorischen Fragestellungen ruhren insbesondere aus der scheinbaren Unstrukturiertheit der Materie und den deshalb fehlenden Prufungs- und Aufbauschemata. Hier schafft das Werk Abhilfe. Klar strukturiert vermittelt es die Zusammenhange zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen und der Funktionsweise ihrer Organe. Zahlreiche Falle und Beispiele dienen der Veranschaulichung; Vertiefungs- und Wiederholungsfragen ermoglichen eine gezielte Examensvorbereitung.