Frank Wenzel Bücher

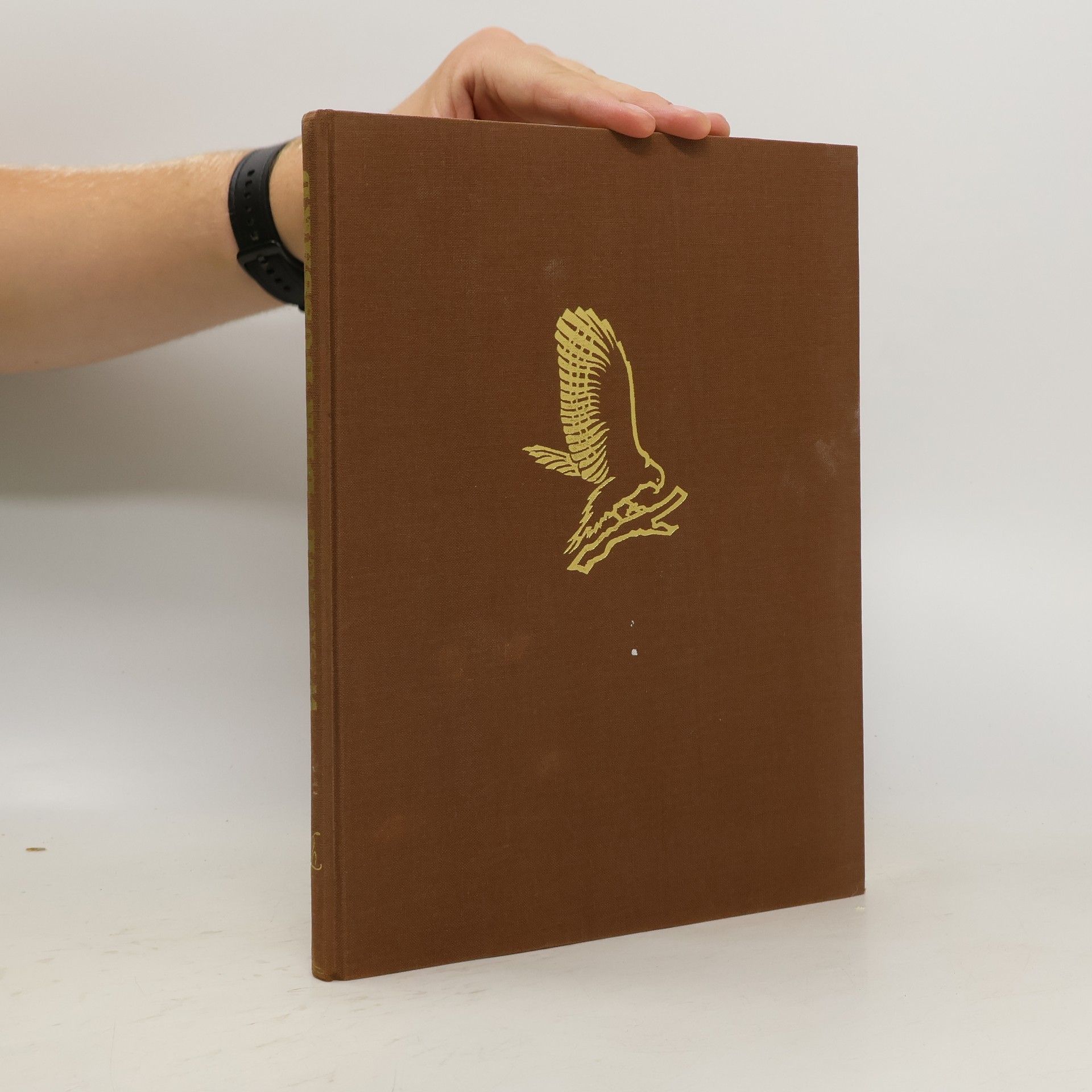
Der Arzthaftungsprozess
Medizinschaden – Fehler – Folgen – Verfahren
Als Gesamtdarstellung des Arzthaftungsrecht führt das Handbuch den Leser Schritt für Schritt durch den Haftungsfall: Vom ersten Kontakt zwischen Arzt und Patienten über die Geltendmachung eines Anspruchs bis zum rechtskräftigen Urteil bzw. zur Schadensaufteilung im Rahmen der Regresshaftung. Viele praktische Beispiele, Arbeitshilfen und Graphiken unterstützen die außerordentliche Darstellungsweise des Buches. Es geht nicht um eine wissenschaftliche Erklärung der Arzthaftung, sondern um ein praxistaugliches Arbeitsmittel für die Bearbeitung von Haftungsfällen. Deshalb sind Musterschriftsätze und Formulare enthalten, Checklisten und Tipps für ein taktische Vorgehen unter Beachtung der unterschiedlichen Interessen. NEU in der 2. Auflage: • Einarbeitung der aktuellen ober- und höchstrichterlichen Rechtsprechung mit aktuellen Praktikertipps • Integrierung weiterer praxisrelevanter Themenfelder wie – E-Health und Telemedizin – Haftung von Apotheker: innen – Haftung von Hebamen – Haftung von Tierärzt: innen – Haftung von Zahnärzt: innen – Haftung in der Notfallmedizin bzw. im Rettungsdienst – Medizintourismus – Zivilrechtliche Haftungsrisiken und Covid-19