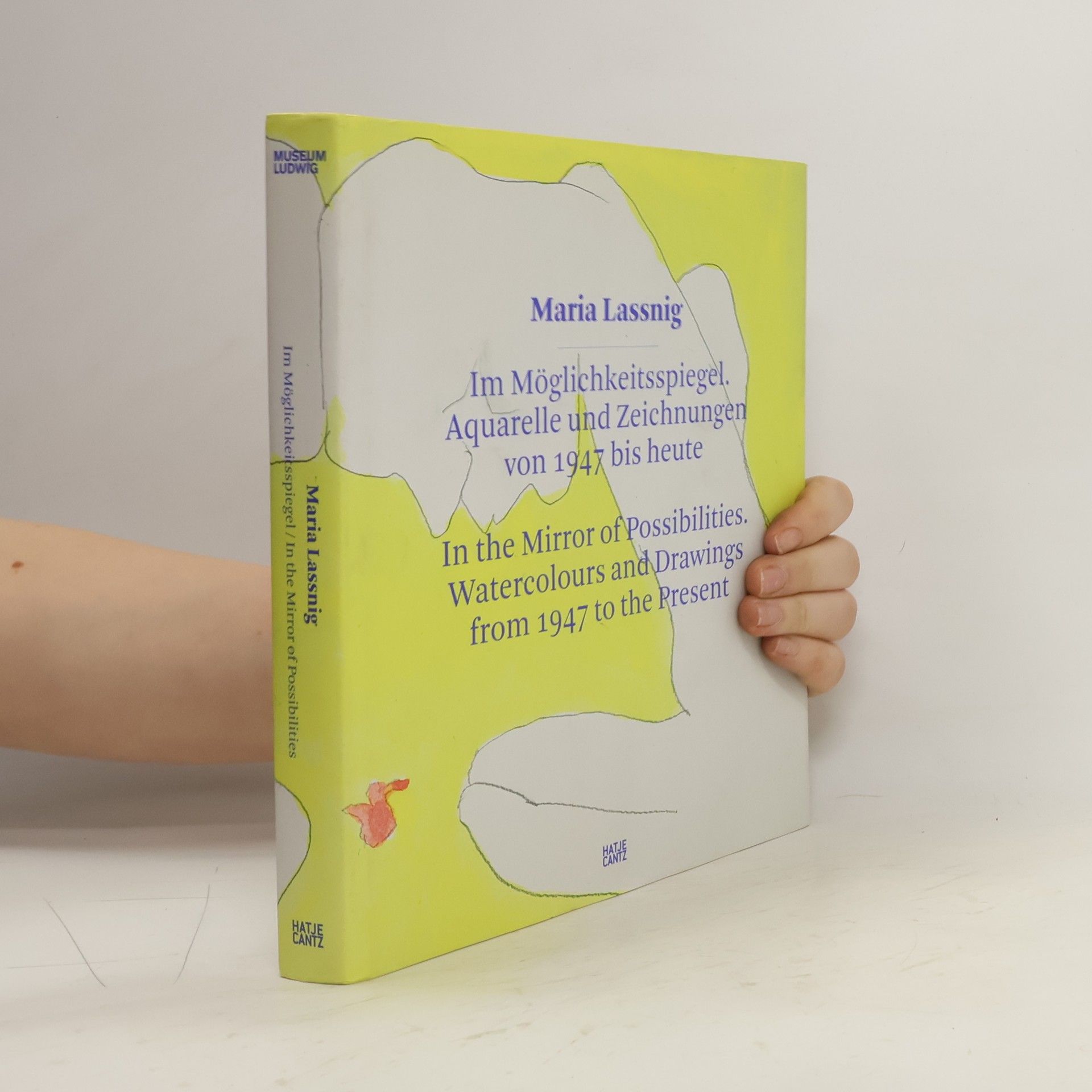Der geteilte Picasso. Der Künstler und sein Bild in der BRD und der DDR
Ausst. Kat. Museum Ludwig, Köln
Was verbinden wir mit Pablo Picasso? Und was haben die Deutschen der Nachkriegszeit mit ihm verbunden, als sein Ruhm auf dem Höhepunkt war? Weitaus mehr als wir. Das zeigt dieser Band, der an eine beeindruckende Breite, Spannung und Produktivität der Aneignung erinnert. Nicht nur um den Künstler geht es hier, sondern um sein Publikum, das sich im kapitalistischen Westen und im sozialistischen Osten Picassos Kunst denkbar verschieden zurechtlegte. Der vorliegende Band, erschienen als Katalog der Ausstellung Der geteilte Picasso im Museum Ludwig, Köln, erzählt dieses Kapitel deutscher Geschichte entlang von zahlreichen Abbildungen: Reproduktionen von politischen Werken Picassos, Installationsansichten, Zeitungsartikeln, Briefen, Flugblättern, Katalogseiten und vielem mehr. Text: Émilie Bouvard, Hubert Brieden, Yilmaz Dziewior, Bernard Eisenschitz, Julia Friedrich, Günter Jordan, Theresa Nisters, Boris Pofalla, Stefan Ripplinger, Georg Seeßlen, Thorsten Schneider, Iliane Thiemann