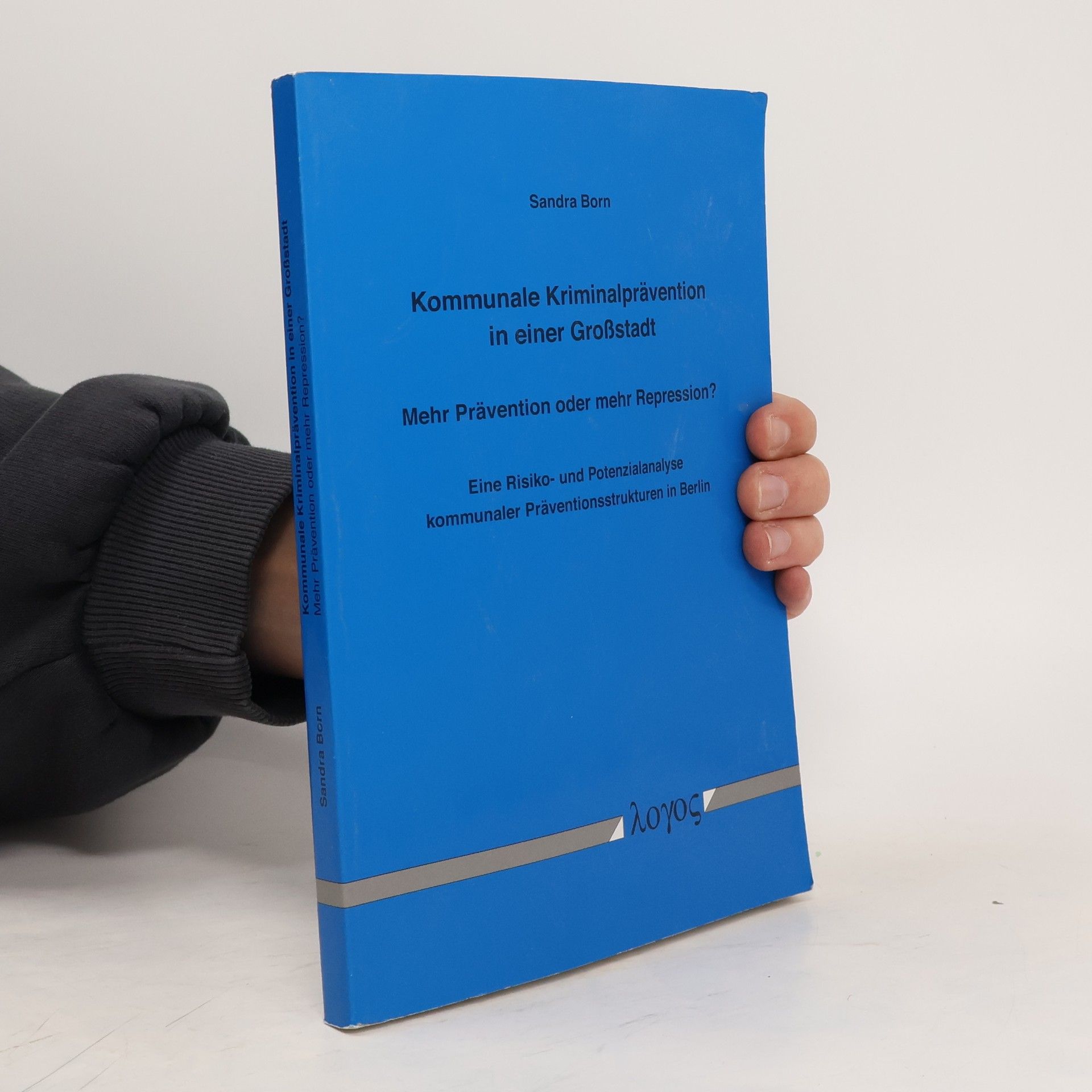Diese Dissertation untersucht einen Paradigmenwechsel in der Kriminalpolitik, bei dem Prävention und Repression als kumulatives Handlungskonzept betrachtet werden. Sandra Born entwickelt ein umfassendes Präventionsverständnis, das die Zusammenarbeit zwischen Polizei und lokalen staatlichen Akteuren des „dritten Sektors“ beleuchtet. Sie analysiert die Potenziale und Risiken einer „neuen Prävention“ und gliedert ihr Untersuchungsfeld in mehrere Aspekte: das Verhältnis von Kriminalität, Ordnung und Sicherheit, die Wahrnehmung von Kriminalität, theoretische Ansätze der Prävention sowie internationale Vergleichsperspektiven. Anschließend widmet sich die Autorin neuen Präventionsstrategien im nationalen Kontext und fokussiert schließlich auf die kommunalen Präventionsstrukturen in Berlin. Die Stärke der Arbeit liegt in der empirischen Analyse dieser Strategien, die in einem einzigartigen Setting verschiedene Akteure der Präventionspolitik einbezieht. Born führt zwei Fallanalysen der Berliner Präventionsräte durch, wobei sie deren Strukturen kompetent aus ihrem beruflichen Erfahrungshorizont heraus erarbeitet. Ihre Analyse stützt sich auf Dokumente der Präventionsräte, Interviews mit fast 30 Experten sowie auf Texte aus teilnehmenden Beobachtungen und Gruppendiskussionen.
Sandra Born Bücher