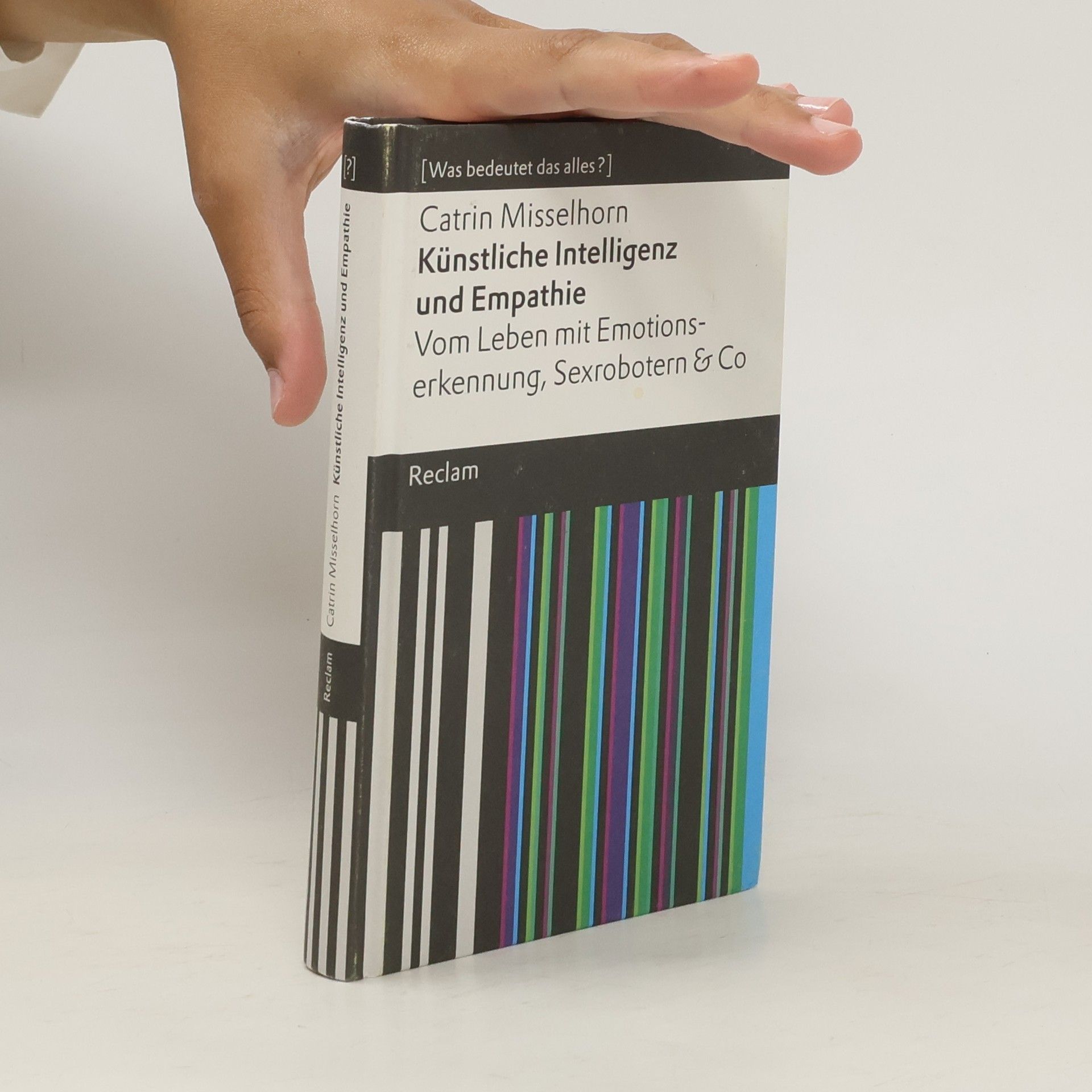Grundfragen der Maschinenethik
Misselhorn, Catrin – Philosophie, Informatik und Robotik; wissenschaftliche Erläuterungen – 19583 – 4., durchges. und überarb. Aufl.
Maschinen werden immer selbständiger, autonomer, intelligenter. Ihr Vormarsch ist kaum mehr zu stoppen. Dabei geraten sie in Situationen, die moralische Entscheidungen verlangen. Doch können Maschinen überhaupt moralisch handeln, sind sie moralische Akteure – und dürfen sie das? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich der völlig neue Ansatz der Maschinenethik. Catrin Misselhorn erläutert die Grundlagen dieser neuen Disziplin an der Schnittstelle von Philosophie, Informatik und Robotik sachkundig und verständlich, etwa am Beispiel von autonomen Waffensystemen, Pflegerobotern und autonomem Fahren: das grundlegende Buch für die neue Disziplin.