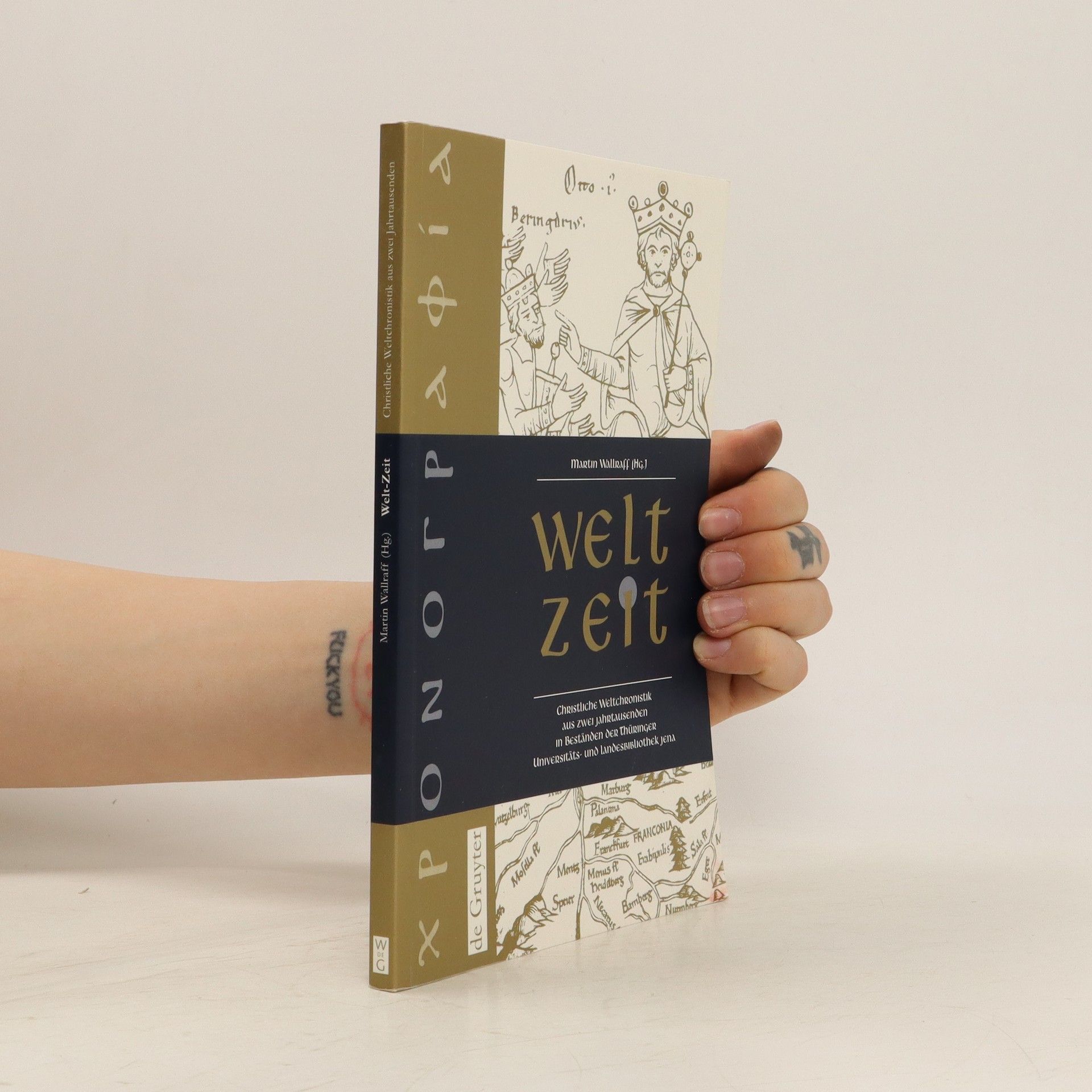Sonnenkönig der Spätantike
- 221 Seiten
- 8 Lesestunden
Kaiser Konstantin (reg. 305-337) ist eine Schlüsselfigur der europäischen Religionsgeschichte. Häufig wird er als „Vater des christlichen Abendlandes“ bezeichnet. Dieses Bild ist im Licht der jüngeren Forschung zu korrigieren. Im vorliegenden Buch wird ein anderes und neues Konstantinbild entwickelt, das Konstantin zwar nicht weniger christlich als bisher angenommen zeichnet, aber doch in seinem Christentum anders, als den zeitgenössichen Theologen lieb sein konnte und als es sich viele moderene Gelehrte vorstellten. Mit der „Sonne“ (dem Sonnengott) als religiösem Leitbild gewinnt der Kaiser als typischer und prägender Exponent seiner Epoche, der Spätantike, an Profil. Und überraschend erweist sich diese Epoche dabei ganz aktuell: eine religionsplurale Gesellschaft, in der Raum war für originelle religiöse Suchbewegungen.