Der historische Kontext des Fojtska, das sich über das heutige Thüringen, Sachsen, Bayern und die Tschechische Republik erstreckt, wird in diesem Buch ausführlich beleuchtet. Es untersucht die jahrhundertealte Herrschaft der Fojtové aus Vidava, Gera und Plauen, die das Gebiet prägten. Die "Kulturní cesta fojtu" führt Leser durch unentdeckte historische Stätten und thematische Routen, die von Kloster zu Kloster und von Kirche zu Kirche reichen. Dabei werden auch die sakrale Kunst und die Denkmäler der vormodernen Stadt- und Wirtschaftsgeschichte vorgestellt.
Christoph Fasbender Bücher

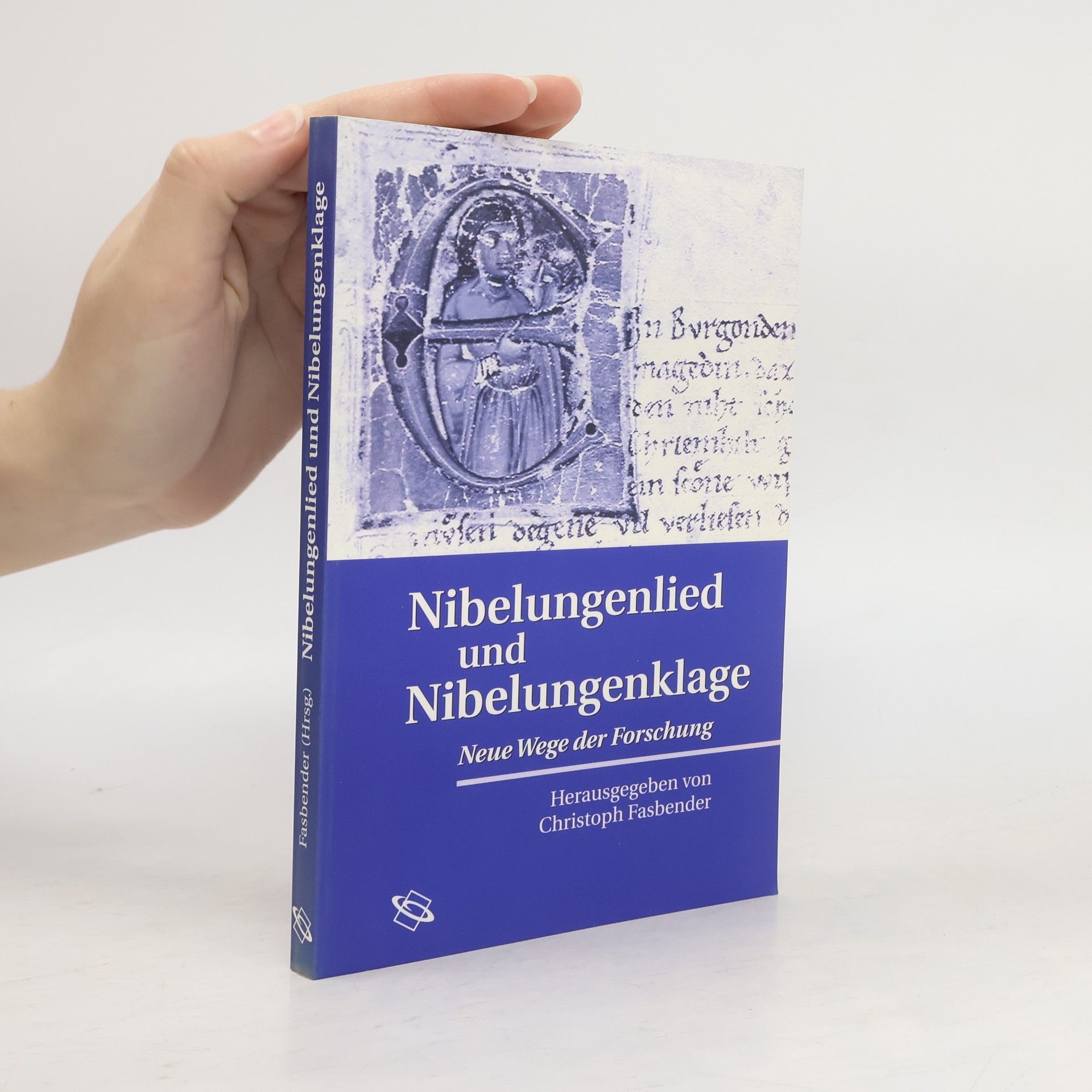




Das Vogtland, die Vögte und die Literatur des Mittelalters
- 252 Seiten
- 9 Lesestunden
Ein Kulturführer, der die erhaltenen baulichen Denkmäler des vormodernen Vogtlandes in ihre geschichtlichen Zusammenhänge stellt.
Herzgebirge
Geschichten aus Urkunden
Der unvorstellbare wirtschaftliche Aufschwung, den die Montanregion Erzgebirge im Spätmittelalter nahm, spiegelt sich in der zeitgenössischen Überlieferung. Mittelalterliche Urkunden, wie sie die Archive der Region bis heute bewahren, zeugen von der Dynamik, die alle Lebensbereiche erfasste: von geglückten und missglückten Rechtsgeschäften, von Konflikten und Versuchen, sie beizulegen, von anspruchsvollen Projekten und solchen, die scheiterten. Alle zusammen bezeugen das Selbstbewusstsein der prosperierenden Städte und ihrer Einwohner, ihre Geschicke tatkräftig zu gestalten. Herzgebirge. Geschichten aus Urkunden versucht, die alten Dokumente für die Gegenwart neu zu erschließen. Dabei geht es nicht um Übersetzungen in eine moderne Sprachgestalt und eine akademische Kommentierung. Die Dokumente sollen vielmehr literarisch transformiert werden. Kurze, pointierte Erzählungen arbeiten heraus, wo der Kern einer alten Urkunde liegt. Sie formulieren aus, was zwischen den Zeilen steht. Sie stellen das Dokument in den nur noch erahnbaren Zusammenhang seiner Entstehung. Die eigene Welt, die die Erzählungen damit schaffen, bietet eine Folie für die moderne Gesellschaft, die vor ihrem Hintergrund bemerken darf, wie bekannt ihr die kleinen und großen Probleme von vor fünfhundert Jahren mitunter vorkommen.
Nibelungenlied und Nibelungenklage
- 239 Seiten
- 9 Lesestunden
Es ist heute kaum noch möglich, sich einen lückenlosen Überblick über die ständig wachsende Zahl von Publikationen zum Nibelungenlied zu verschaffen. Daher bedarf es einer Auswahl der wichtigsten Forschungsbeiträge, die für die Diskussion der letzten 25 Jahre bestimmend waren. Der vorliegende Band versammelt rund ein Dutzend Aufsätze, die als repräsentativ bezeichnet werden können. Das Interesse der Autoren gilt dabei vor allem Motiven, Figuren, Zeitgeschichte und Rezeption, aber auch dem literarischen Status des Nibelungenliedes und poetologischen Fragestellungen, die lange Zeit vernachlässigt wurden. Der Band bietet so eine fundierte Einführung ins Thema und eine solide Basis für die weitere Arbeit.
The Reeves' Progress
A Cultural Journey of Discovery through Late Medieval Vogtland
- 448 Seiten
- 16 Lesestunden
Focusing on the historical and cultural development of the Vogtland region, this book explores the influence of the Reeves dynasty over centuries. It provides a topographic journey through late medieval Vogtland, highlighting estates, churches, and sacred art, while examining the Teutonic Order's impact. The richly illustrated content showcases key monuments and delves into pre-modern municipal and economic history, offering a comprehensive look at this largely unresearched territory within parts of Germany and the Czech Republic.