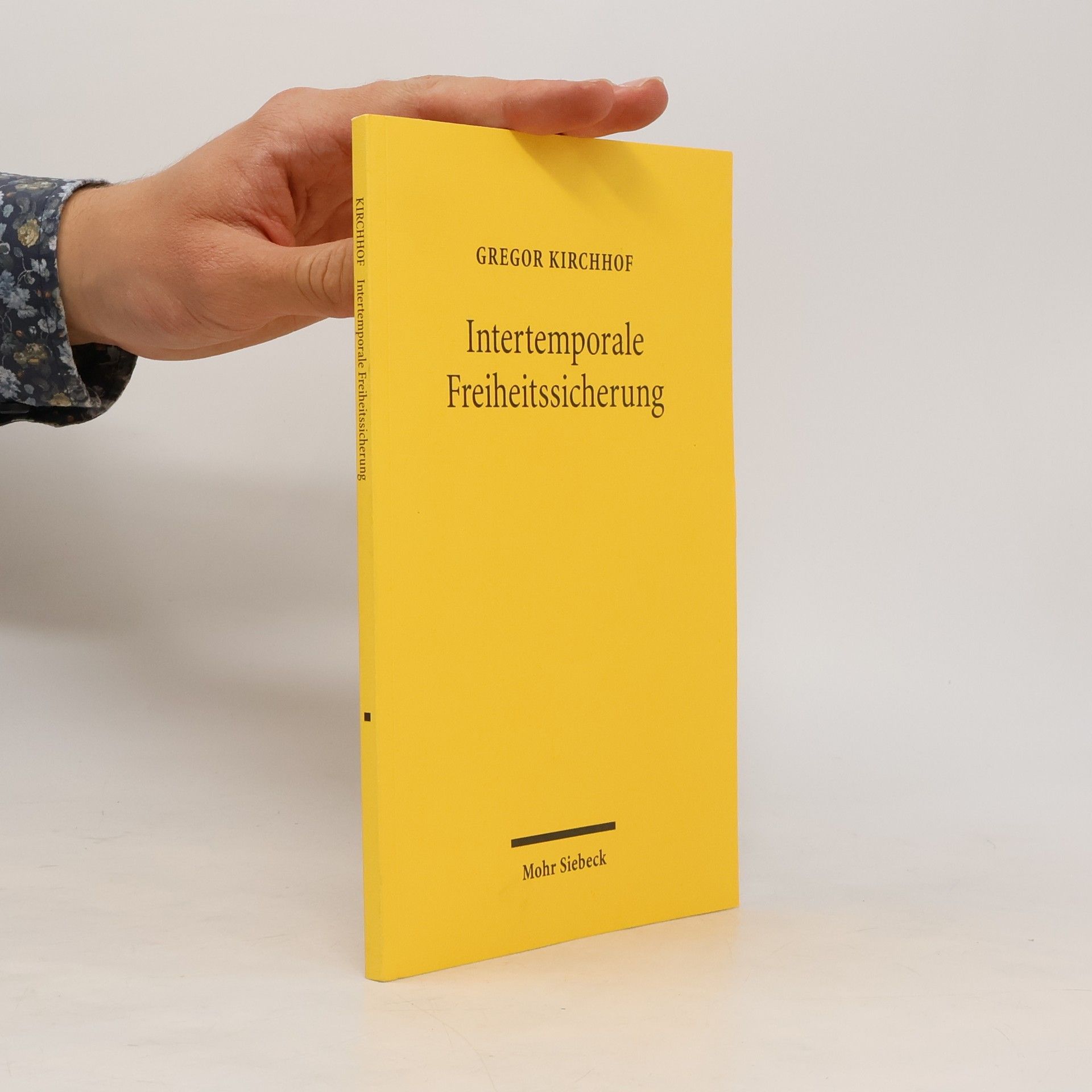Das Recht auf unentgeltliche Sicherheit
Zur Sicherheitsgebühr bei Risikoveranstaltungen
- 105 Seiten
- 4 Lesestunden
Die Einführung einer Bremer Sicherheitsgebühr für Fußballvereine, die bei sogenannten "Risikospielen" von Störern wie Hooligans betroffen sind, wirft grundlegende Fragen zur Verantwortlichkeit und den Rechten im Verfassungsstaat auf. Die Vereine würden für Gewalt außerhalb ihrer Kontrolle finanziell bestraft, während die tatsächlichen Verursacher ungestraft bleiben. Dies könnte nicht nur die Freiheit bei Sport- und Kulturveranstaltungen gefährden, sondern auch die Prinzipien der unentgeltlichen Sicherheit untergraben, die für alle Bürger, unabhängig von ihrem Status, gelten sollten.