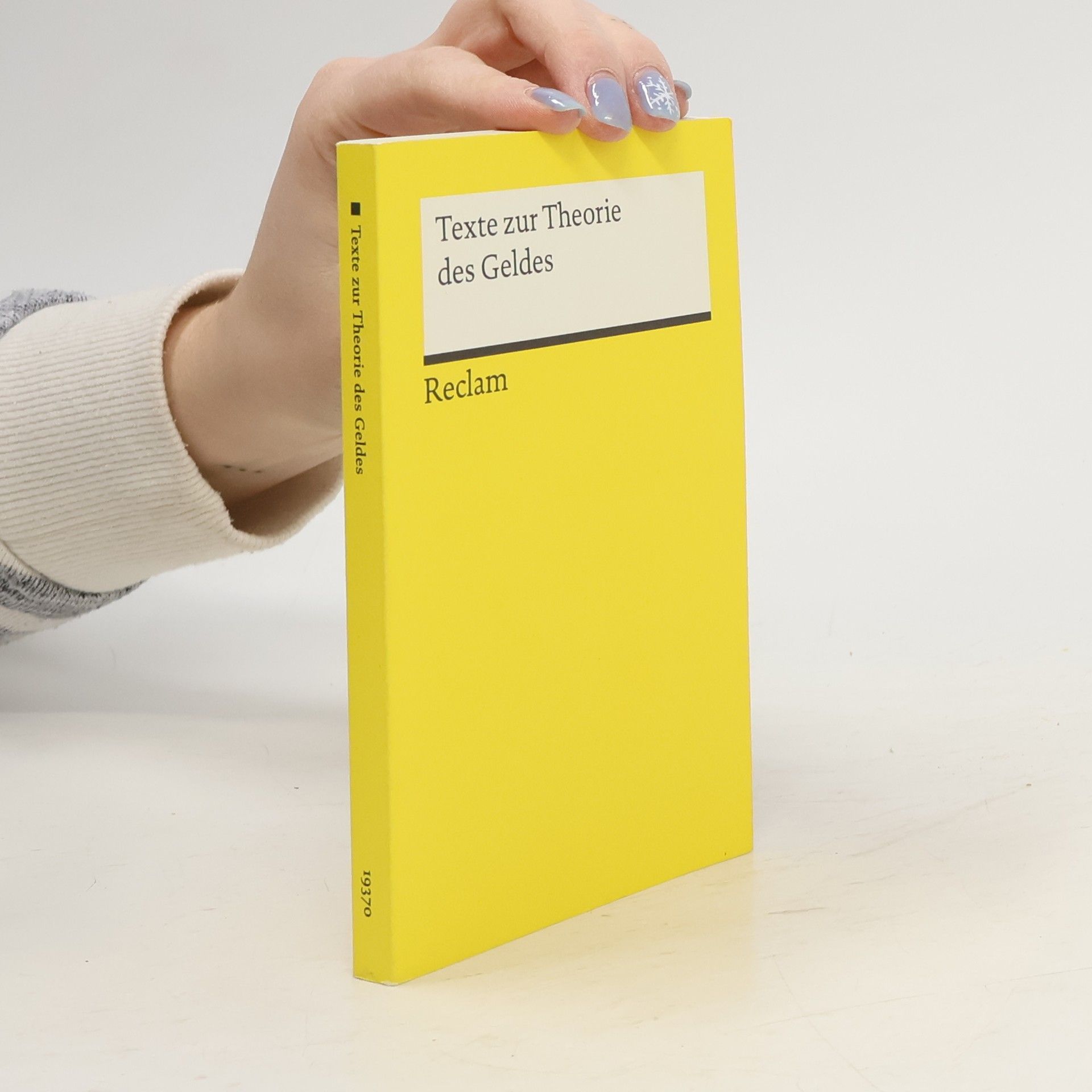Anthropologie in der klassischen deutschen Philosophie
- 345 Seiten
- 13 Lesestunden
"Die Frage nach dem Wesen des Menschen ist als Frage nach uns selbst eine genuin philosophische. Häufig werden als klassische Entwürfe philosophischer Anthropologie vor allem solche des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts angesehen, die in Auseinandersetzung mit den expandierenden Erkenntnissen der Einzelwissenschaften entstanden. Dieser Fokus vernachlässigt jedoch die grundsätzliche und eigenständige Beantwortung der Frage, die bereits in der klassischen deutschen Philosophie gegeben wurde. Hier findet sich ein intensives Nachdenken darüber, wie die Frage überhaupt beantwortet werden kann und welche Bedingungen die menschliche Natur für ein vernunftgemässes Leben mit sich bringt. Die Autoren des vorliegenden Bandes zeigen die Notwendigkeit auf, sich mit diesen Ansätzen auseinanderzusetzen"--Page 4 of cover.