Carmen Puchianu Bücher

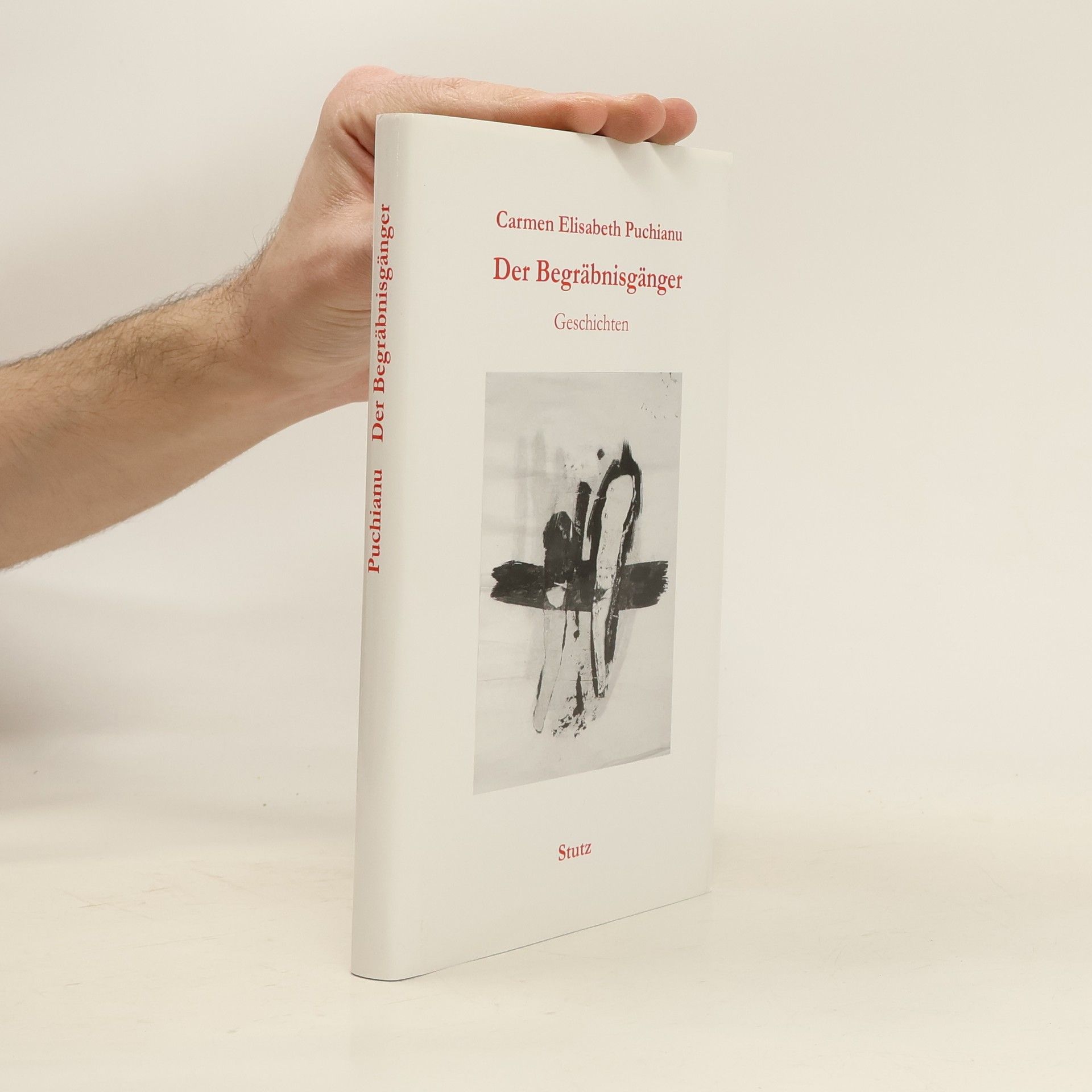
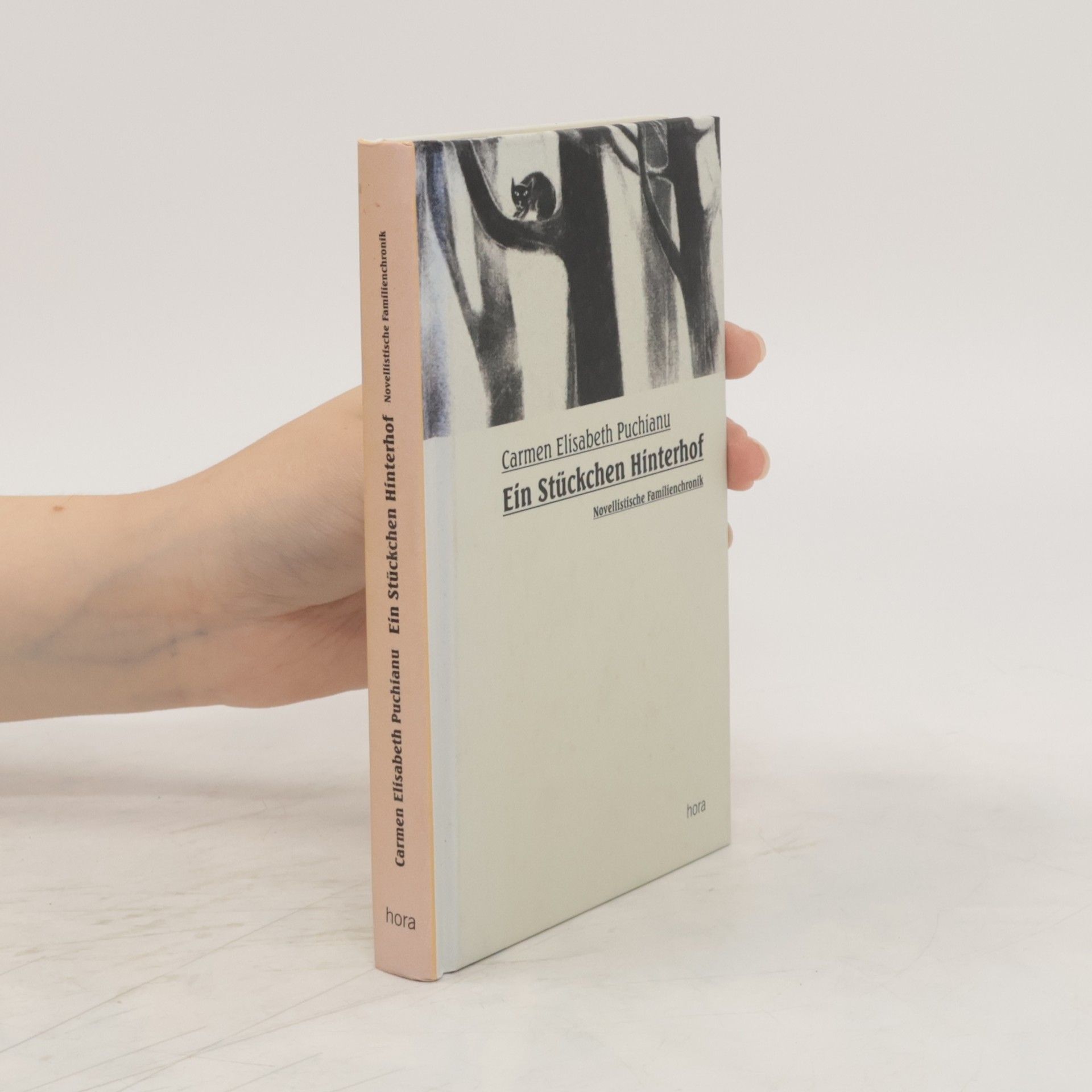
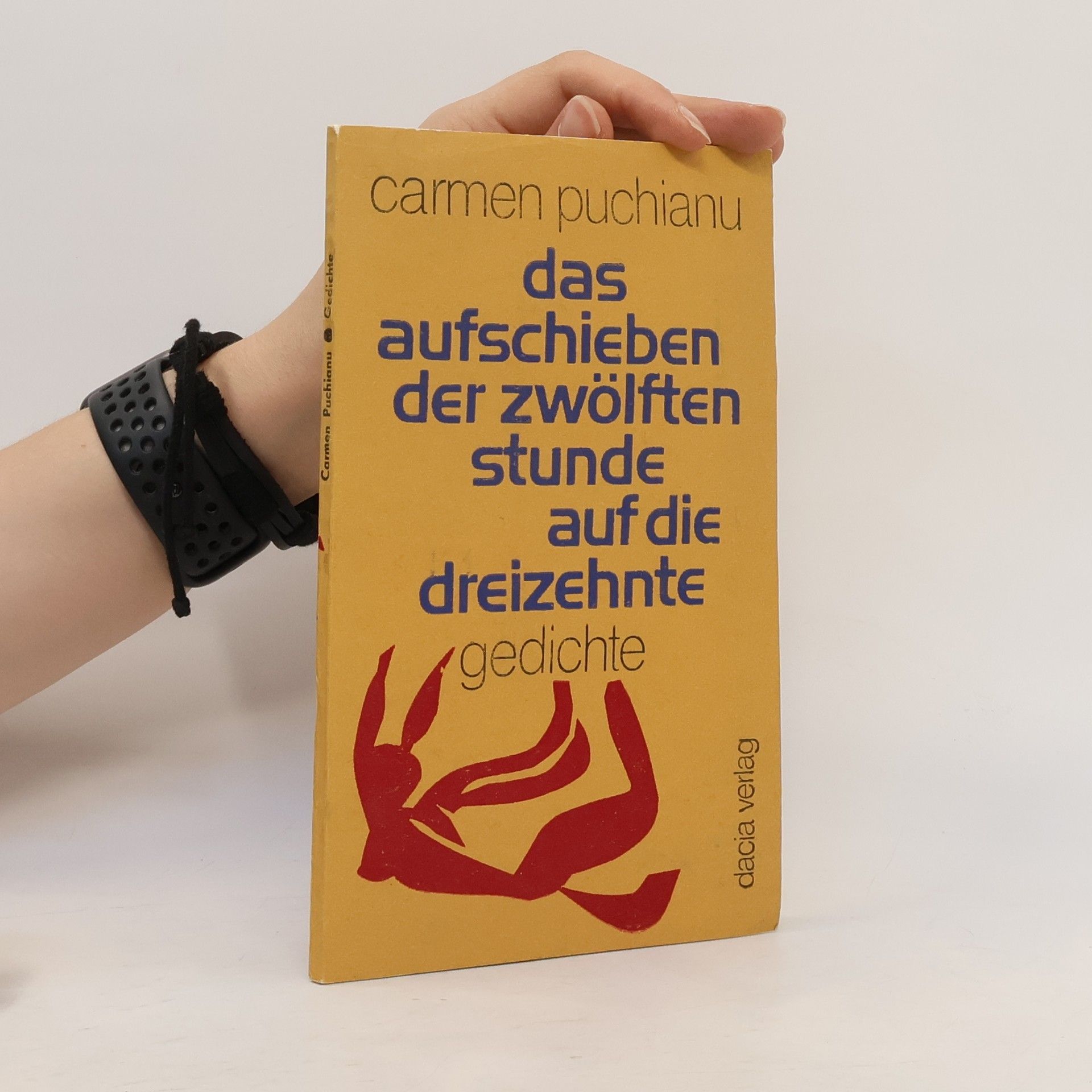
Inhalt I. Literaturwissenschaft: Ronny F. Schulz untersucht Alterität und Interkulturalität im Kontext von Wahrnehmung und Manierismus. Paweł Wałowski diskutiert die Rolle des Autors und die Bestimmung des Autobiographischen in fiktionalen Erzählungen. Mariana-Virginia Lăzărescu analysiert die Balance zwischen Fiktionalität und Authentizität in Carmen Elisabeth Puchianus Geschichte „Nach-Lese“. Raluca Dimian Hergheligiu thematisiert die Voraussetzungen der Intermedialität im fotografischen Diskurs der Moderne. Robert G. Elekes beleuchtet die Emanzipationsmechanismen in Herta Müllers Werken. Delia Cotârlea betrachtet Heimatrepräsentationen in der rumäniendeutschen Lyrik des 20. Jahrhunderts, während Alexandra Greavu die Sprachmanipulation im Kabarettdiskurs bei Dieter Hildebrandt analysiert. II. Übersetzungswissenschaft: Åsa Apelkvist reflektiert über Übersetzungen von Verbidiomen im schwedischen Kriminalroman „Verblendung“. Carmen Elisabeth Puchianu bietet eine praktische Übersetzungskritik anhand einer zweisprachigen Edition von Celan-Gedichten. III. Sprachwissenschaft: Sigrid Haldenwang untersucht Raritäten und Reliktwörter im Siebenbürgisch-Sächsischen. Adina-Lucia Nistor analysiert medizinische Fachbegriffe wie -itis, -iasis und -osis. Doris Sava betrachtet Neologismen aus lexikografischer Sicht. Cornelia Pătru führt eine kontrastive Studie zu euphemistischen Berufsaufwertungen durch. Mihaela Parpalea reflektiert über Spra