Ein vermeintlich gewöhnlicher Sonnabend in Berlin Nordost. Schulle trotzt dem Sturm Zeynep, den Unwägbarkeiten des Glücksspiels und seinen schnippigen Kolleginnen im Zeitungs-Lotto-Tabak-Kram-Laden. Kraut, der neue Kumpel, kommt auch nicht schüchtern rüber. Ihre Dialoge sind Gefechte, ein ewiges Friendly Fire. „Immer höflich zu de Kundschaft, och wenn se bekloppt is!“ Schulle kennt so einige Turbulenzen, ob als Betreuer für Demenzkranke, als Zusteller an der Post-Front oder als Scherge beim Wachschutz. Hoch lebe der heitere Klassismus! „Wo früher in den Häusern nur Freunde und Bekannte lebten, bejegnen dir heute inne Hausflure einije Helden und Jespenster aus Funk und Fernsehen.“
Andreas Glaser Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
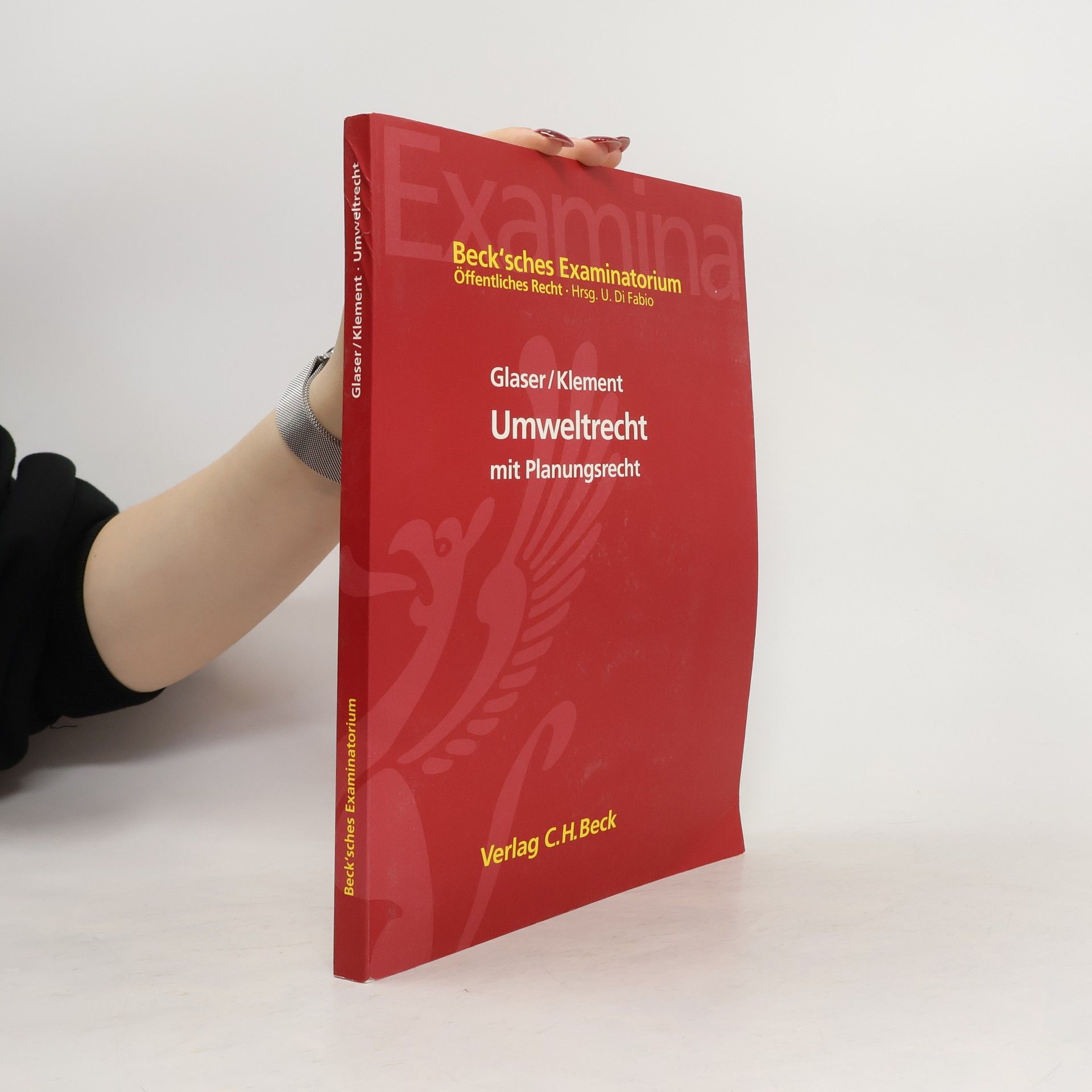

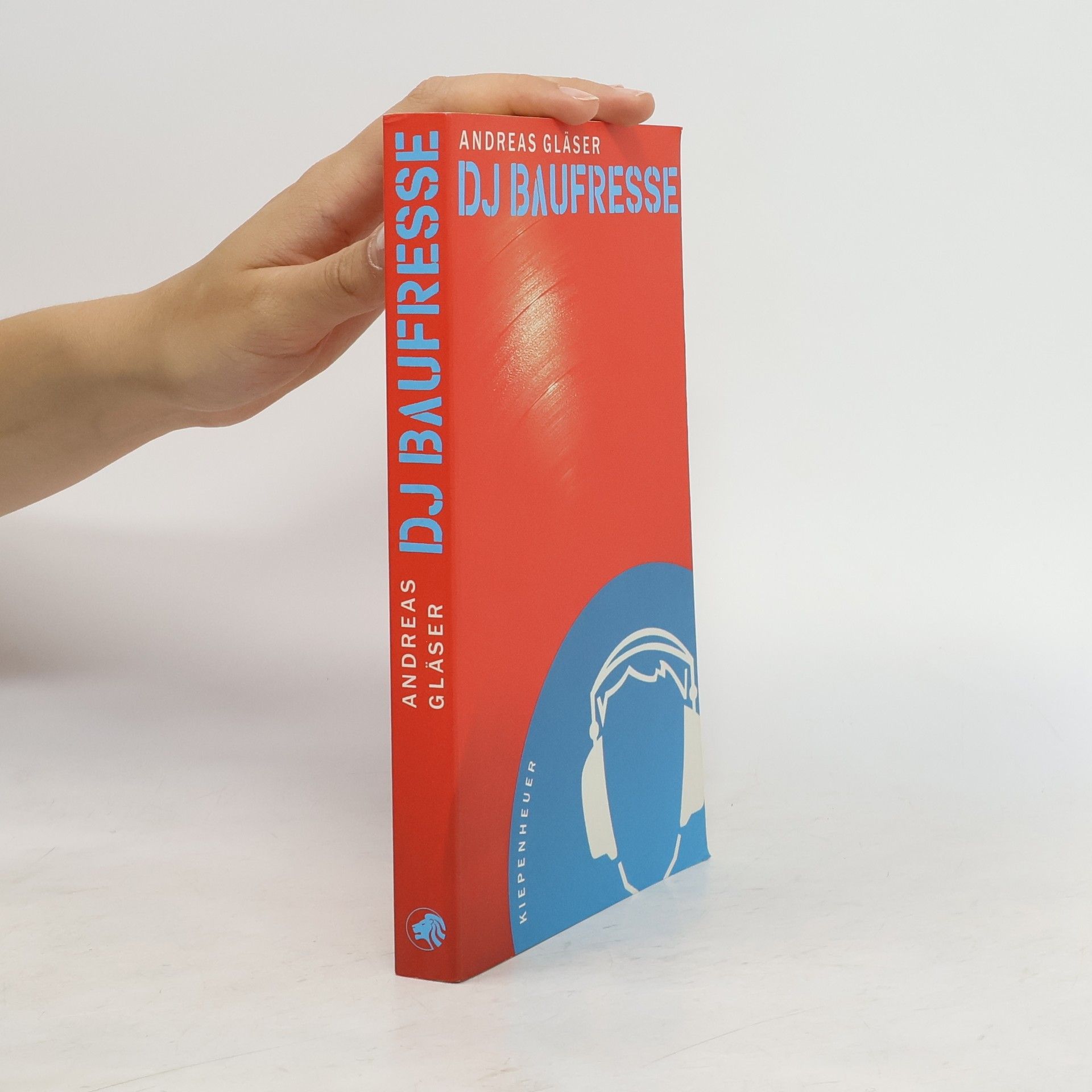
Zum Werk In zehn großen Fällen vermittelt der neue Band das examensrelevante Wissen im Umweltrecht und im Planungsrecht. Er verschafft einen Überblick über die Grundlagen, vertieft exemplarisch ausgewählte Fragen, schult die Argumentationstechnik und schärft den Blick für die Bezüge zum Allgemeinen Verwaltungsrecht, zum Verwaltungsprozessrecht und zum Verfassungsrecht. Vorteile auf einen Blick - Umwelt- und Planungsrecht erstmals in induktiver Lernmethode - bundeslandübergreifende Darstellung - Berücksichtigung prozessualer Fragen Inhalt - Umweltrecht - Klimaschutzrecht - Bodenschutzrecht - Immissionsschutz - Bau- und Bauplanungsrecht - Umwelt- und Planungsrecht - Naturschutz- und Wasserrecht - Umweltinformationsrecht - Gentechnikrecht. Zu den Autoren Die Autoren sind Akademische Räte a. Z. am Institut für Deutsches und Europäisches Verwaltungsrecht an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Zielgruppe Für Studierende der entsprechenden Schwerpunktbereiche.
DJ Baufresse
- 216 Seiten
- 8 Lesestunden
Eine Chronik des Durchhaltens und des lustvollen Versagens, die komisch und unverwechselbar ist. Im Mittelpunkt steht das Alter ego "DJ Baufresse", das grandios an sich selbst und der Gesellschaft scheitert. Der junge Autor feiert den Alltag und bietet eine "tour de force" der Gewöhnlichkeiten.