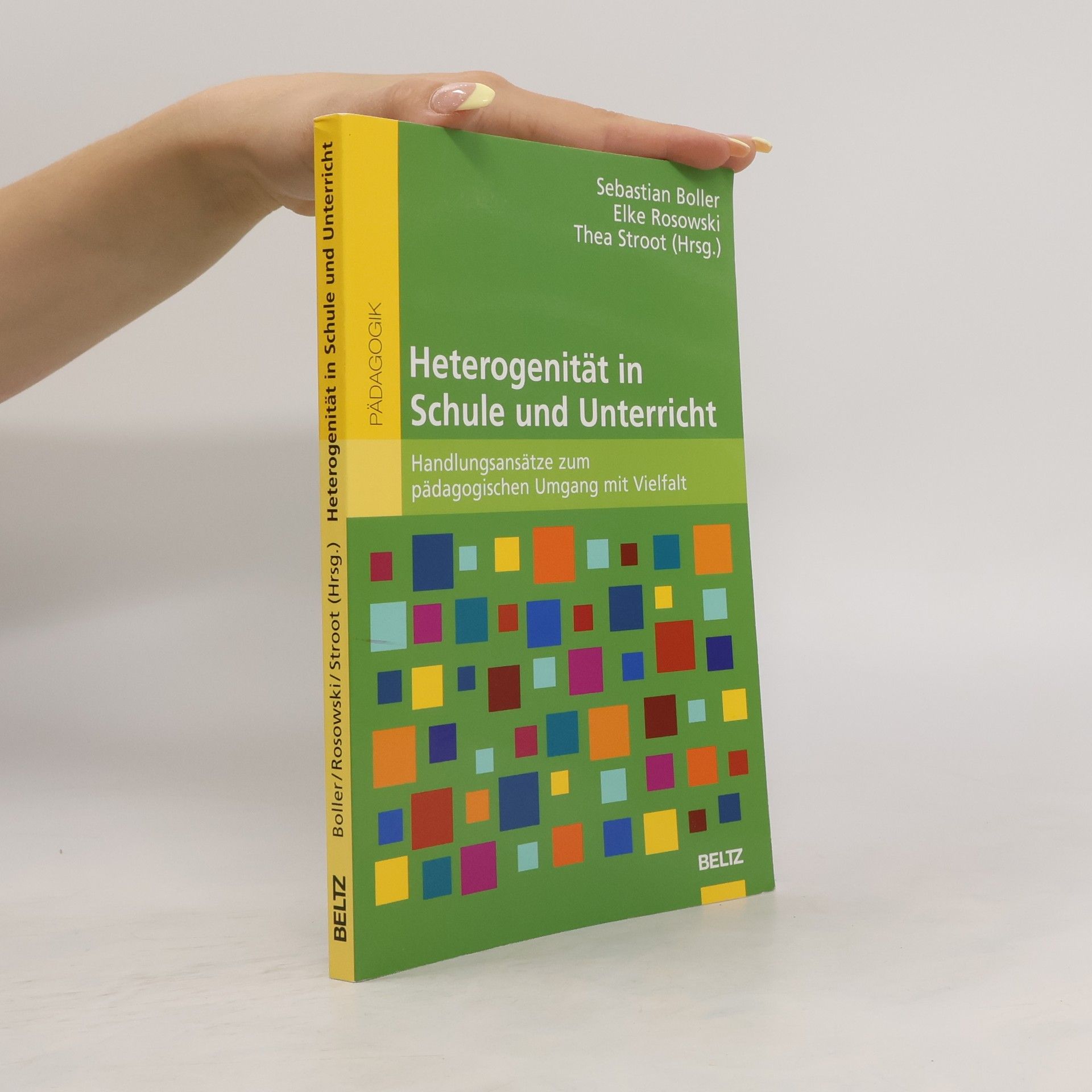Heterogenität in Schule und Unterricht
- 183 Seiten
- 7 Lesestunden
Das Thema Heterogenität hat seit PISA einen hohen Stellenwert in der pädagogischen Diskussion. Dieses Buch zeigt, wie Vielfalt für Schule und Unterricht fruchtbar gemacht werden kann. Stichworte dabei sind etwa: - individuelle Förderung - neue Lernkultur - Förderdiagnostik - Flexibilisierung von Bildungswegen Im Mittelpunkt des Buches stehen praxisorientierte Handlungsansätze zum pädagogischen Umgang mit Vielfalt. Dabei spielen Konzepte der Sprachförderung ebenso eine Rolle wie problem- und erfahrungsorientierter Unterricht, Schulsozialarbeit und Fragen der Unterrichtsevaluation. Mit einer theorieorientierten Einführung in die Themen „Vielfalt im Schulwesen“ und „Vielfalt als Forschungsthema“.