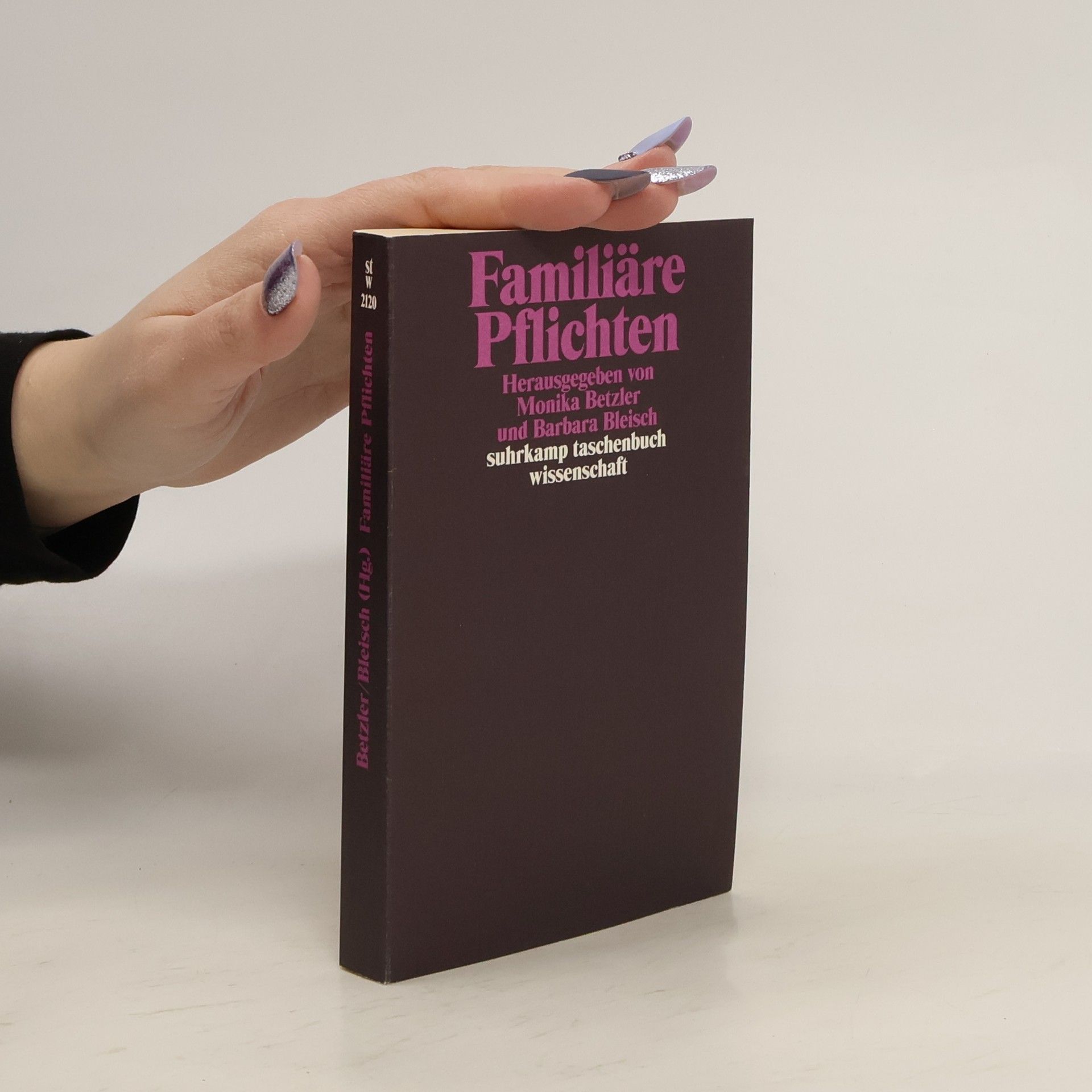Familiäre Beziehungen gehen mit einer Reihe von Pflichten einher, deren Begründung und Inhalt umstritten sind. Sie lassen sich nicht unabhängig davon bestimmen, was eine Familie ausmacht. Jenseits dieser Definitionsfrage spielen in der aktuellen moralphilosophischen Debatte verschiedene Typen familiärer Pflichten eine zentrale Rolle: parentale Pflichten, die Eltern ihren Kindern schulden, filiale Pflichten von Kindern gegenüber ihren Eltern und fraternale Pflichten zwischen Geschwistern. Der Band führt umfassend in die Thematik ein. Die Beiträge stammen von Norbert Anwander, David Archard, Rüdiger Bittner, Harry Brighouse, Anca Gheaus, Johannes Giesinger, Axel Honneth, Simon Keller, Claudia Mills, Amy Mullin, Laura M. Purdy, Christian Seidel, Adam Swift und Ursula Wolf.
Monika Betzler Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)