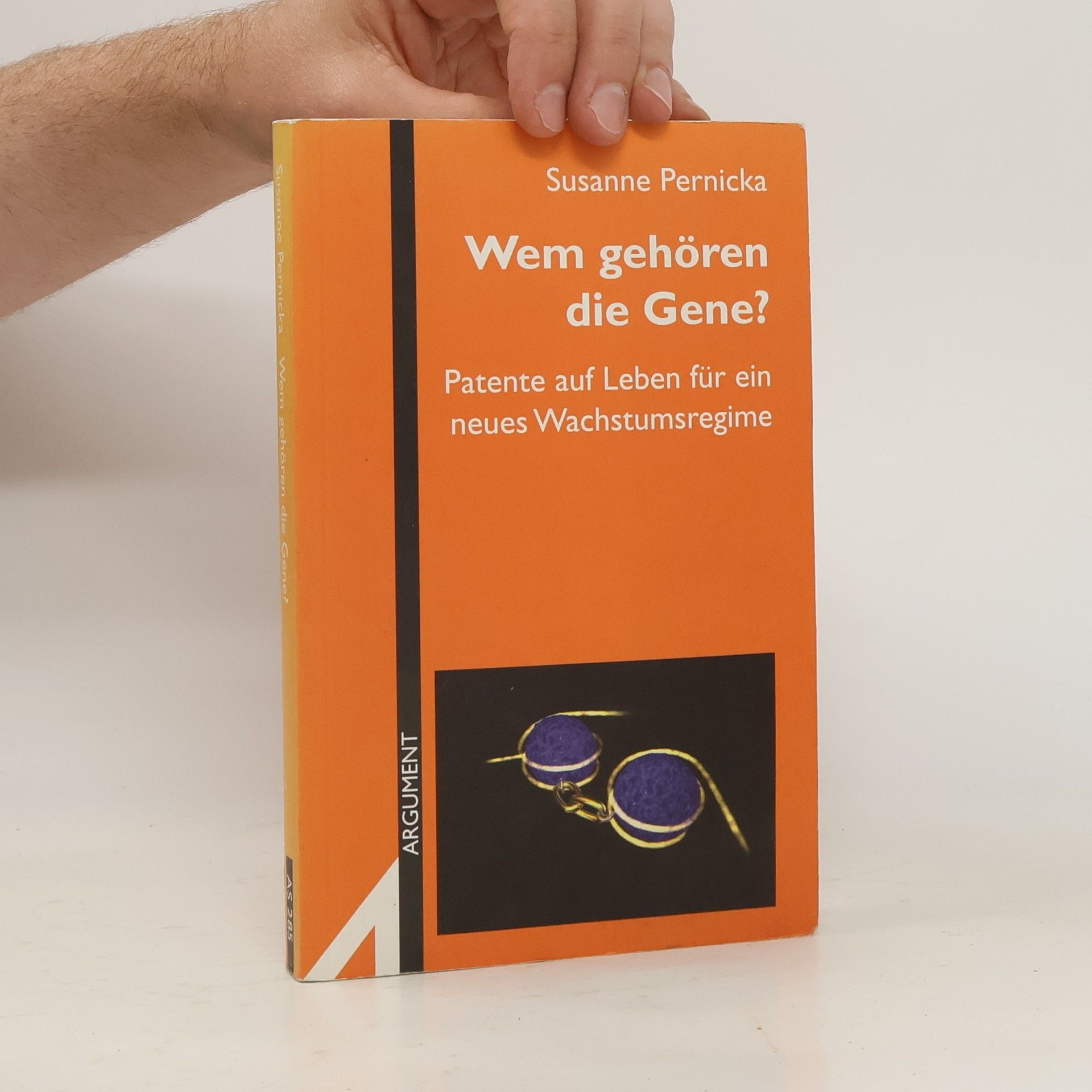Die Kommerzialisierung der GeneDie Autorin verweist auf die Widersprüchlichkeit eines ungebremsten ökonomischen Wachstums auf Basis der privatrechtlichen Herrschaft über die Gene. Diese zeigte sich eindrucksvoll in der jahrelangen Auseinandersetzung zwischen BefürworterInnen und GegnerInnen von Patenten auf Leben um eine Europäische Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen.
Susanne Pernicka Bücher