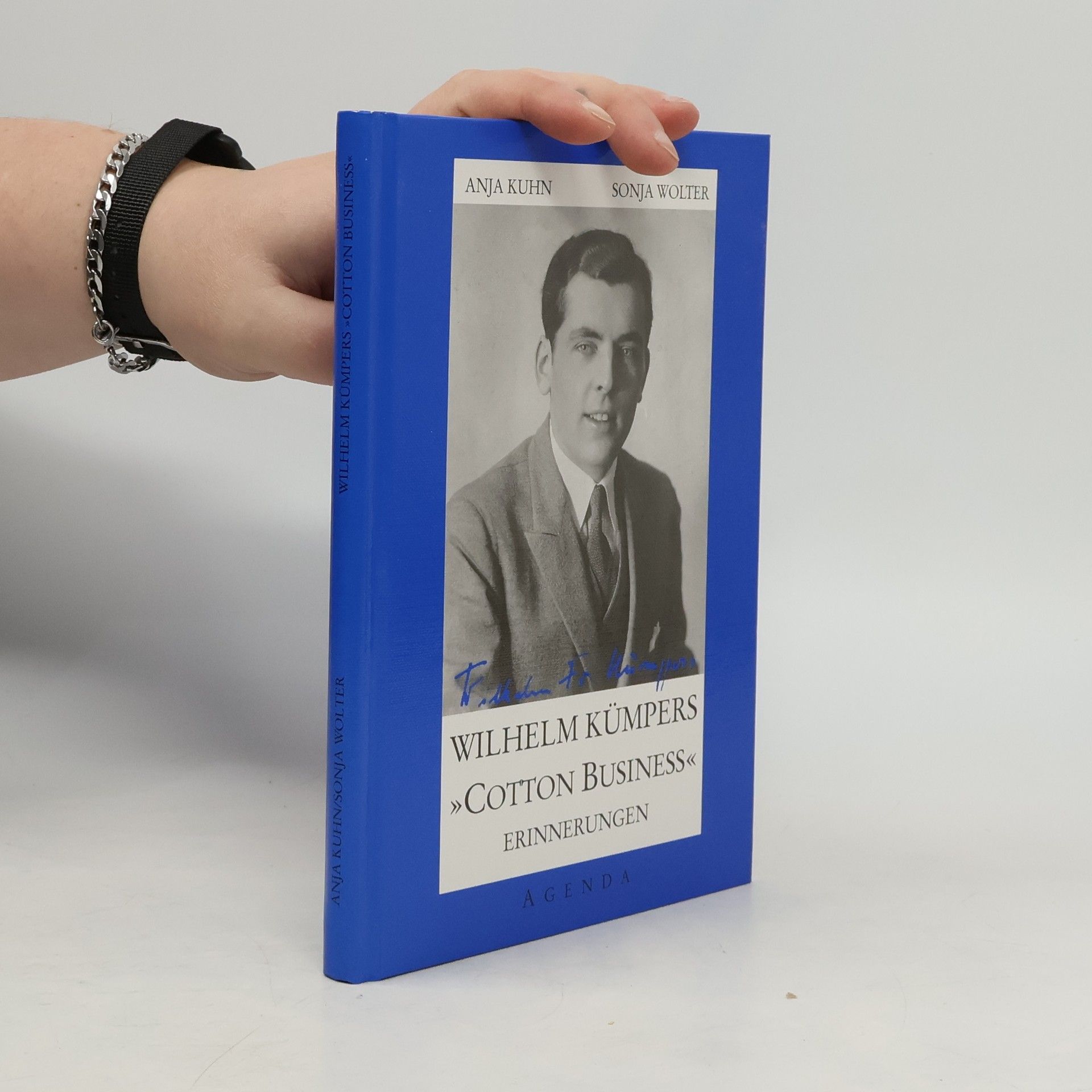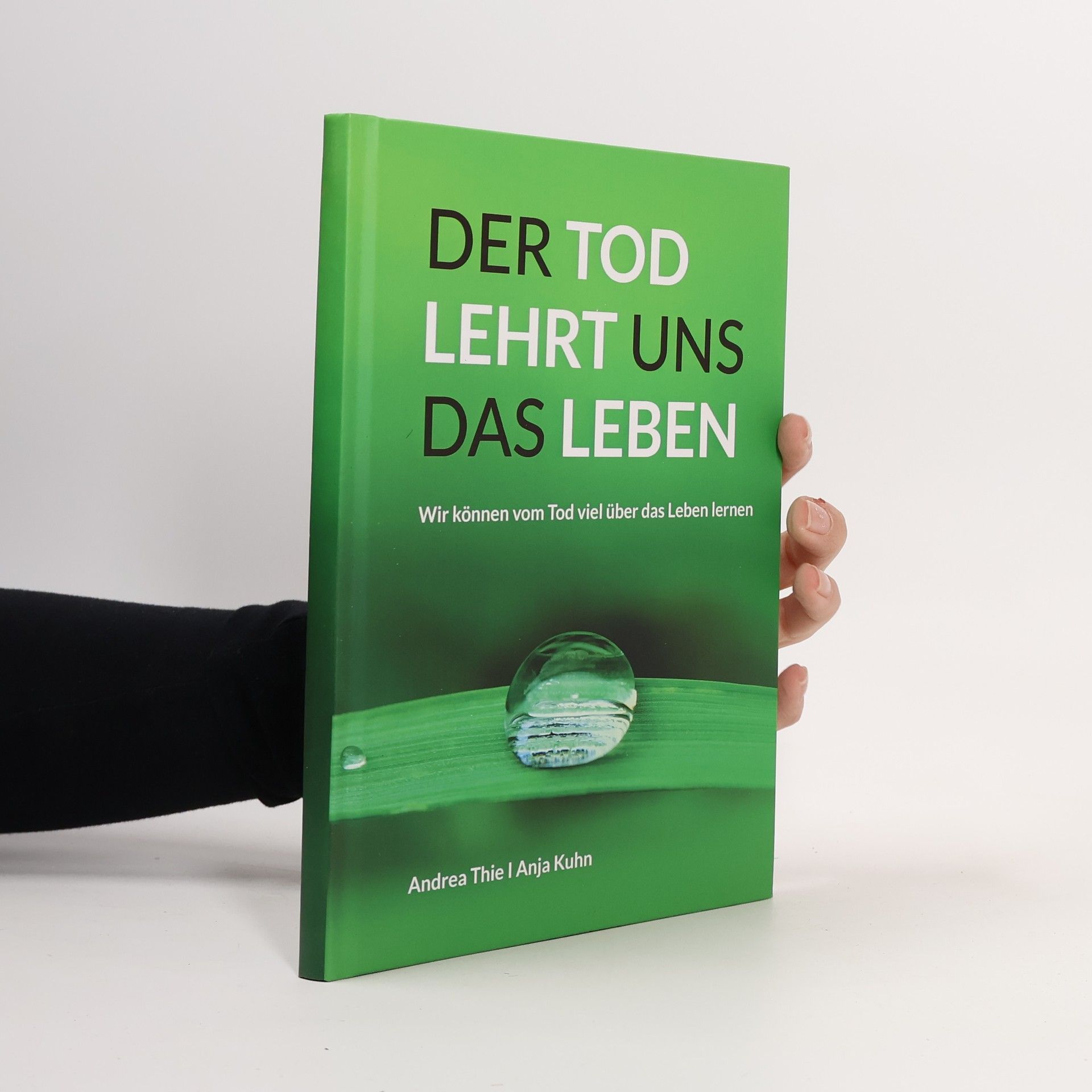In diesem Buch erzählen wir die Lebens-Geschichten von Andrea Thie. Jede dieser Geschichten hat Andrea selbst erlebt. Andrea lässt uns an ihren Gefühlen teilhaben, die sie im Laufe ihres Lebens in die sicheren Schubladen ihrer inneren Kommode weggepackt hat und zu unterschiedlichen Zeiten als Erwachsene hervorholte, um zu heilen. Jede ihrer Geschichten erzählt vom Vertrauen in das Leben. Vertrauen darauf, dass nichts einfach nur so geschieht, sondern dass das Leben uns führt. Die wichtigste Geschichte handelt von ihrem Nahtod-Erlebnis. Sie beschreibt eindrücklich, emotional und in starken Bildern, was ihr passiert ist. Sie ist davon überzeugt, dass sie diese Erfahrung aus einem guten Grund machen musste und sie sie nicht nur für sich selbst erlebt hat, sondern für uns alle.
Anja Kuhn Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)