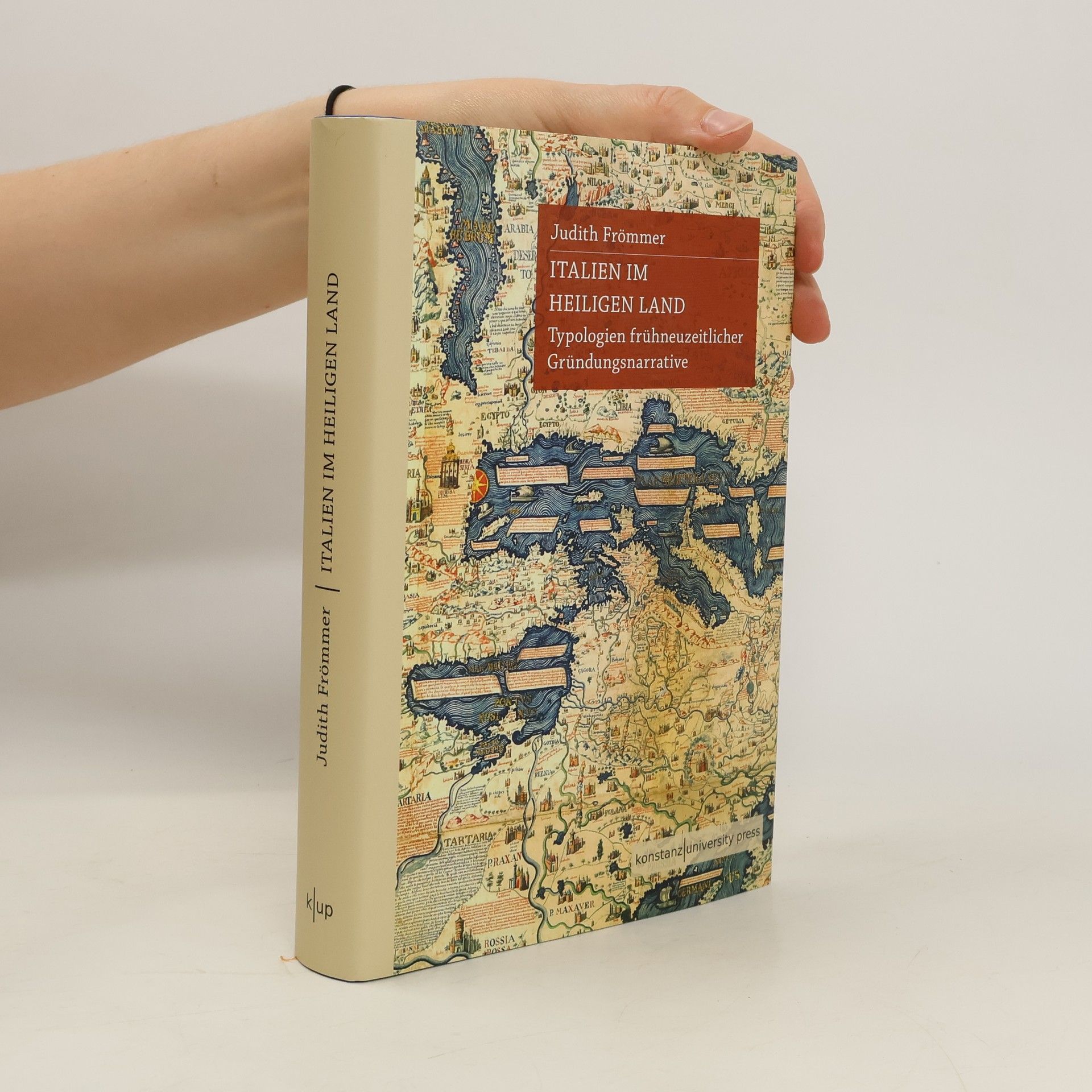Italien im Heiligen Land
Typologien frühneuzeitlicher Gründungsnarrative
Was treibt das Italien der Renaissance ins Heilige Land? Judith Frömmer untersucht, wie die Rede vom Kreuzzug, die von Niederlage und Verlust handelt, in der blühenden Kultur der italienischen Stadtstaaten für verschiedene Gründungsnarrative vereinnahmt wurde. Die Kreuzzüge gelten als Inbegriff einer mittelalterlichen Kultur und als unrühmliches Kapitel der europäischen Geschichte. Dennoch wird im Italien der Renaissance von neuen Kreuzzügen nach Jerusalem gesprochen, während Autoren von Reiseberichten, Predigten und Ritterepen aus Genua, Florenz und Ferrara zum Kampf um die Heilige Stadt aufrufen. Warum erfreuen sich diese Geschichten, die aus europäischer Sicht zum endgültigen Verlust des Heiligen Landes führten, gerade dort einer so anhaltenden Popularität? Und welche Rolle spielen sie bei der Gründung und Stabilisierung einer Gemeinschaft? Sei es in Columbus' Entdeckung einer „neuen Welt“, der von Genua aus das Heilige Grab zurückerobern will; in Savonarolas Ausrufung eines „neuen Jerusalem“ für das republikanische Florenz; oder in den Epen von Ariosto und Tasso, die literarisch neues Terrain reklamieren: Diese Autoren verlegen Italien ins Heilige Land und erzählen zugleich eine alternative Gründungsgeschichte ihres eigenen Landes. Im Spannungsfeld von Rom und Jerusalem entfaltet sich diese Geschichte nicht über eine gelingende Meistererzählung, sondern über typologische Deutungsmuster, die erst in der Nachträglichkeit der