Populäre Liturgiken als Quellen der Liturgiewissenschaft des 19. Jahrhunderts
- 200 Seiten
- 7 Lesestunden
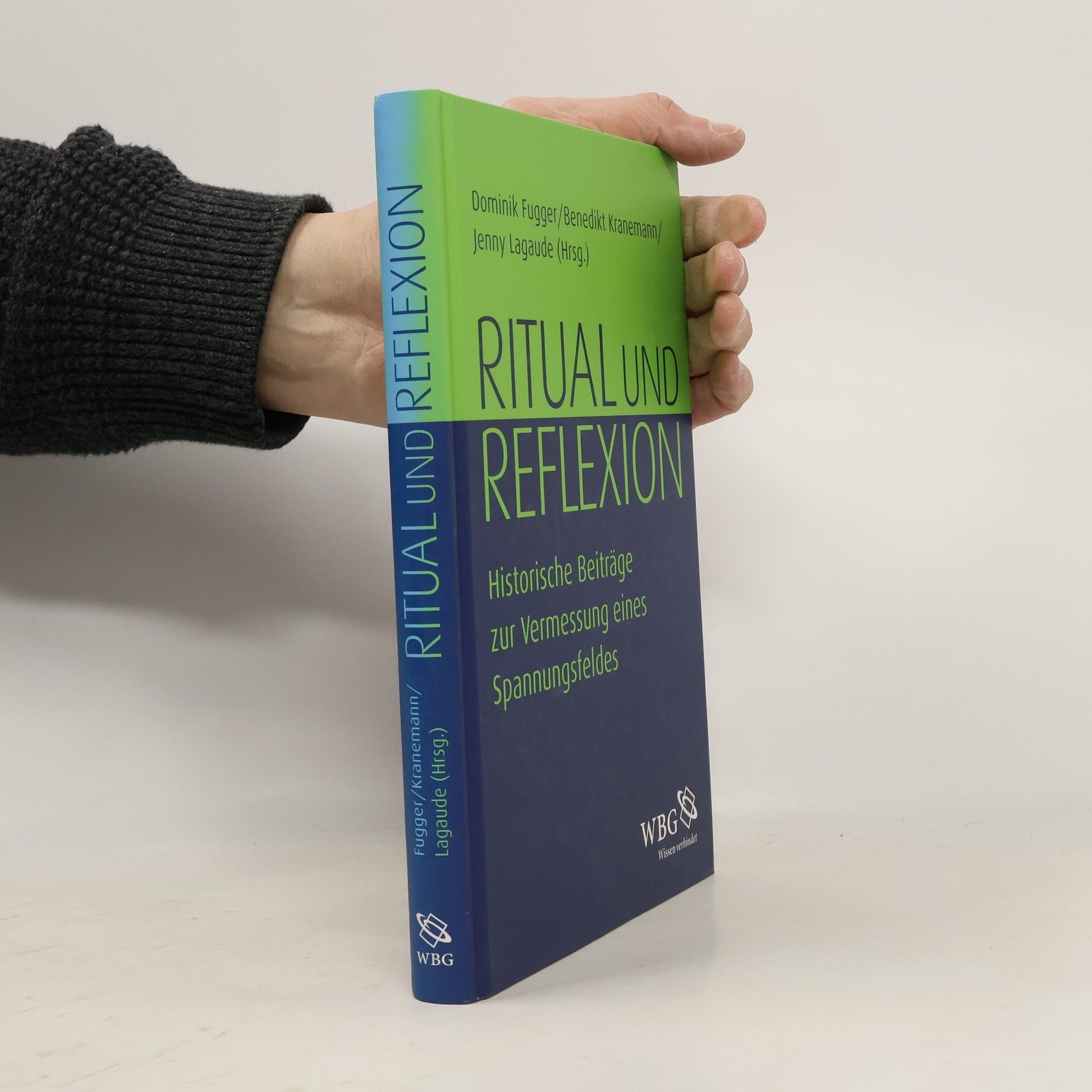


Die Liturgiewissenschaft als theologische Disziplin steht vor besonderen Herausforderungen, insbesondere in der Zeit nach dem Konzil. Die Veränderungen in Kirche, Liturgie und dem gesellschaftlichen Umfeld haben die Art und Weise, wie der christliche Glaube gelebt und gefeiert wird, erheblich diversifiziert. Neben den traditionellen Pfarrgemeinden sind zahlreiche neue Orte des Gottesdienstes und Gebets entstanden, die sowohl stabil als auch zeitgebunden sind. Ökumenische Aspekte und die Beziehungen zu anderen Religionen spielen eine wichtige Rolle, ebenso wie die Einbettung in ein kulturelles Umfeld, das viele verschiedene Rituale umfasst. Dies wirft neue Fragen zur Liturgiefähigkeit des Menschen und zur Menschenfähigkeit der Liturgie auf. Zudem erfordert das Verständnis der Liturgiewissenschaft eine Klärung im Kontext der zukünftigen Entwicklung der universitären Theologie und ihres interdisziplinären Profils. In diesem Buch wird die Frage erörtert, welche Aufgaben und Beiträge die Liturgiewissenschaft in der Theologie, der Wissenschaft, der Kirche und der Gesellschaft in naher Zukunft leisten kann. Stimmen aus verschiedenen theologischen Disziplinen und kirchlichen Arbeitsfeldern tragen zu dieser Diskussion bei.
Historische Beiträge zur Vermessung eines Spannungsfeldes
Rituelles Handeln und eine bewusste, kritische Haltung zur Welt scheinen zunächst im Widerspruch zueinander zu stehen. Doch schon die Schaffung eines Rituals setzt reflexive Prozesse voraus. Die unterschiedlichsten Interessen, Vorstellungen, Welthaltungen und emotionalen Erwartungen finden ihren Niederschlag im Ritual und im rituellen Vollzug. Erstmals wird in diesem Band das spannende Verhältnis von Ritual und Reflexion untersucht. Renommierte Wissenschaftler geben neue Impulse in interdisziplinären Beiträgen, die von der Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft, Philosophie bis hin zu Liturgiewissenschaft und Judaistik reichen. Sie diskutieren die Bedeutung symbolischen Handelns, das Verhältnis von Inhalten und ihren Ausdrucksformen, die Relevanz ritualdynamischer Prozesse sowie die Funktion des Rituals für den Menschen im Wandel der Zeit.