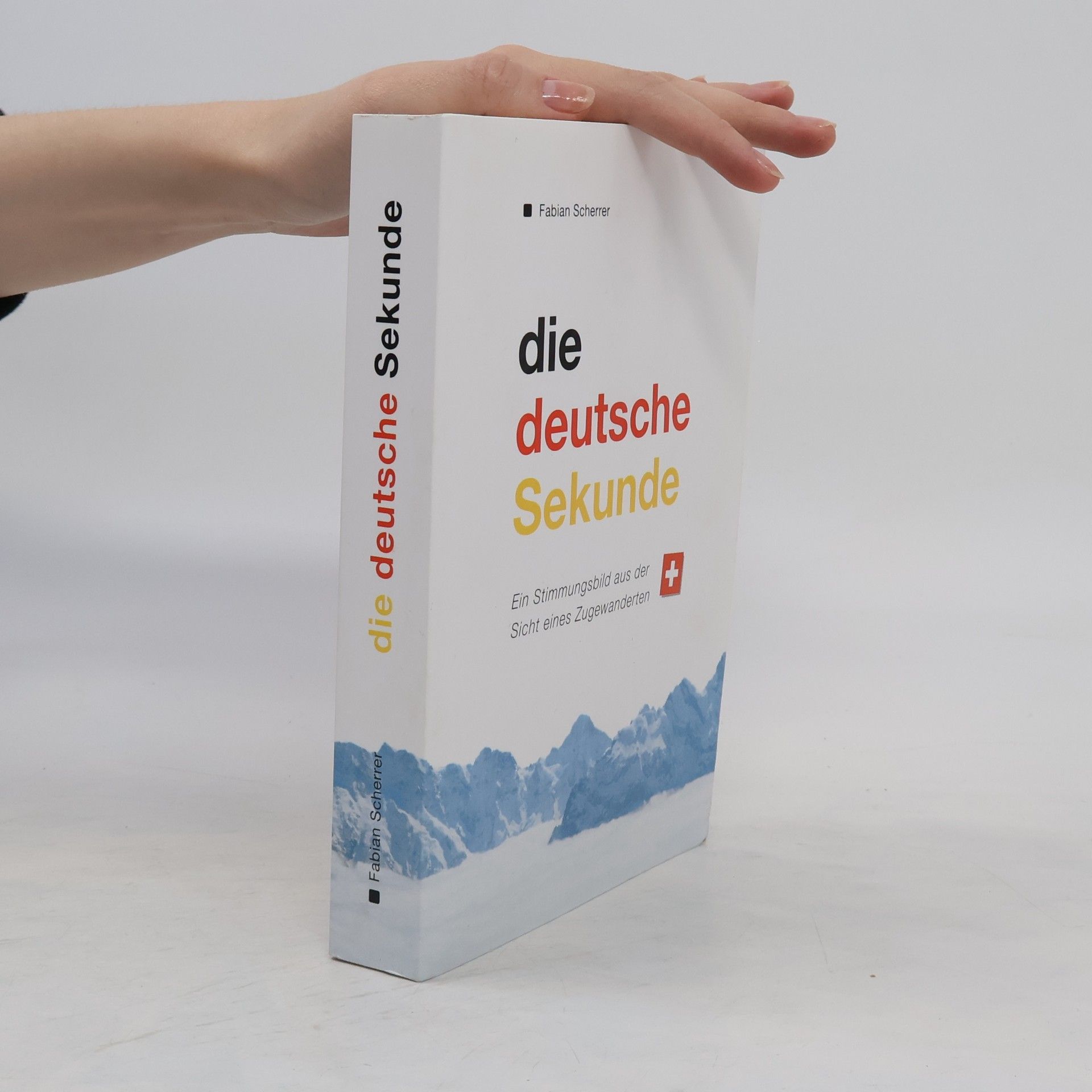Fabian Scherrer entwirft ein Psychogramm einer Gesellschaft, in der Political Correctness und der Neoliberalismus den Alltag und die Gedanken dominieren. Mit satirischem Biss skizziert er Deutschland und seine Hauptstadt aus der Perspektive eines Schweizern, der nach Berlin gezogen ist. Der Autor hält den Deutschen einen Spiegel vor, in dem sowohl liebenswerte als auch verschrobene Eigenschaften sichtbar werden, ebenso wie die unbewältigten Traumata der NS-Vergangenheit und der Teilung in Ost und West. Auf seinen nächtlichen Streifzügen durch die Berliner Republik beleuchtet er das naive Verhältnis vieler Deutscher zu Einwanderern und deren Kulturen, das ohne die Erfahrungen der jüngeren Geschichte schwer zu verstehen ist. In den Katakomben des deutschen Unbewussten trifft er auf Menschen, die zwischen Minderwertigkeits- und Selbstüberhebungsgefühlen schwanken und ihren Platz in Europa suchen. Scherrer beschreibt Deutschland als eine Art Gastgeberin, die sich mit eigenen Unsicherheiten und einem übertriebenen Hygienebewusstsein auseinandersetzt. Diese Metapher verdeutlicht, wie tief verwurzelt die Ängste und moralischen Ansprüche sind, die aus traumatischen Erfahrungen resultieren. So wird das Bild einer Gesellschaft gezeichnet, die trotz ihrer Verrücktheiten nicht böse, sondern einfach verwirrt ist.
Fabian Scherrer Bücher