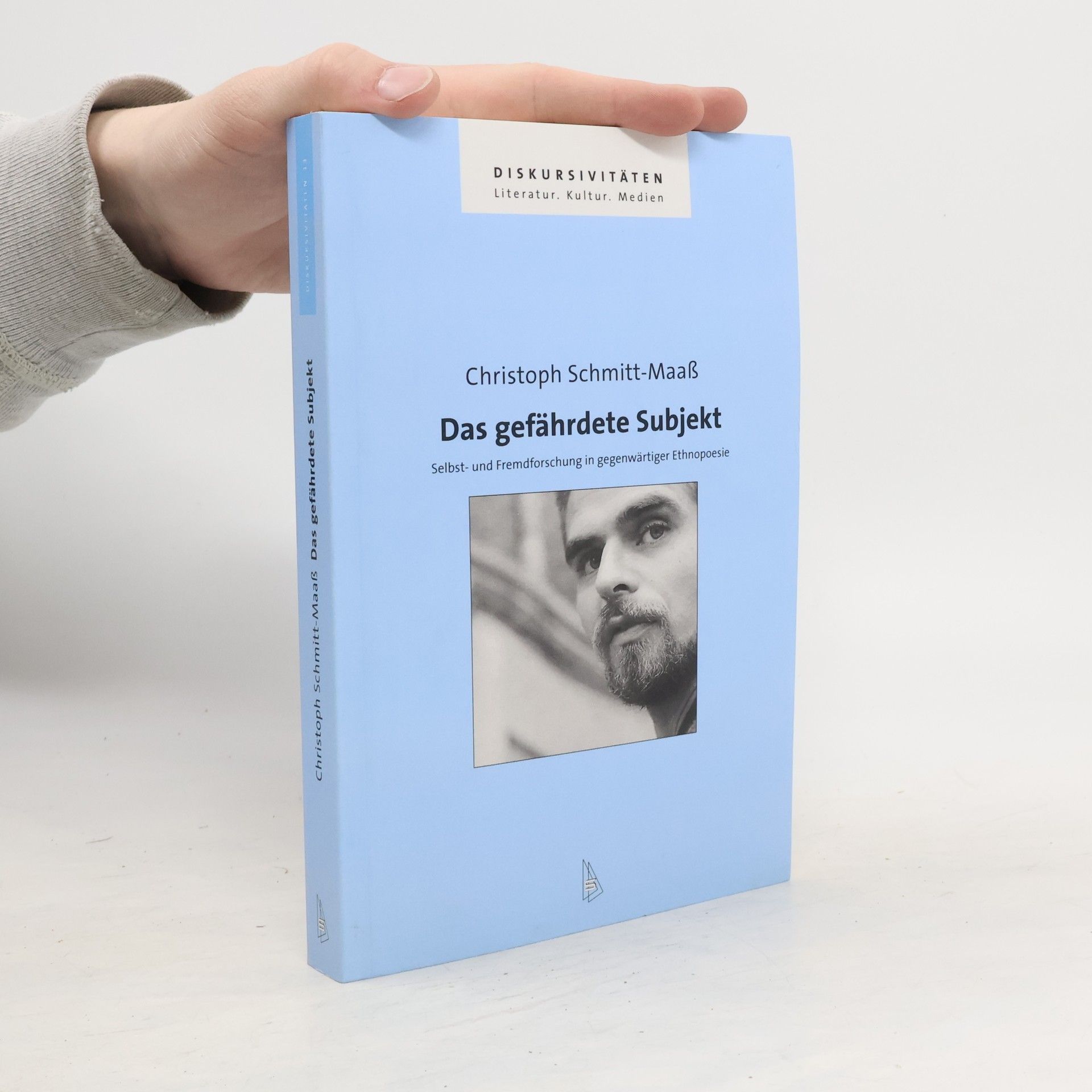Der Jansenismus im deutschsprachigen Raum, 1670–1789
Bücher, Bilder, Bibliotheken
In den letzten Jahren hat der Jansenismus verstärkt das Interesse der Forschung geweckt, insbesondere im Hinblick auf frömmigkeitliche Praktiken. Während die Forschung zu Flandern, Frankreich und Italien gut etabliert ist, wird der Jansenismus im deutschsprachigen Raum erst seit den 1970er Jahren intensiver untersucht, wobei die theologische Forschung erst kürzlich an Bedeutung gewonnen hat. Dabei wird oft übersehen, dass der Jansenismus auch hier zahlreiche Fürsprecher und Förderer hatte. Die Beiträge des vorliegenden Bandes untersuchen die Akteure, die den Jansenismus im Alten Reich unterstützten, sei es durch adlige Patronage, Übersetzungen oder den Druck und Vertrieb jansenistischer Schriften. Dieser Ansatz soll das konkrete Interesse am Jansenismus sowie dessen Instrumentalisierung für unterschiedliche, teils divergierende Zwecke sichtbar machen. Die Studien kombinieren Ansätze der Materiellen Kultur mit klassischer Buch- und Lesergeschichte, Sozietätsgeschichte, Netzwerkforschung und Rezeptionsforschung. Über die spezifischen Fragen der (katholischen) Theologie hinaus verdeutlichen die Beiträge die transkonfessionelle Relevanz des Jansenismus für Literatur, Kunst, Netzwerkbildung und Buchhandel.