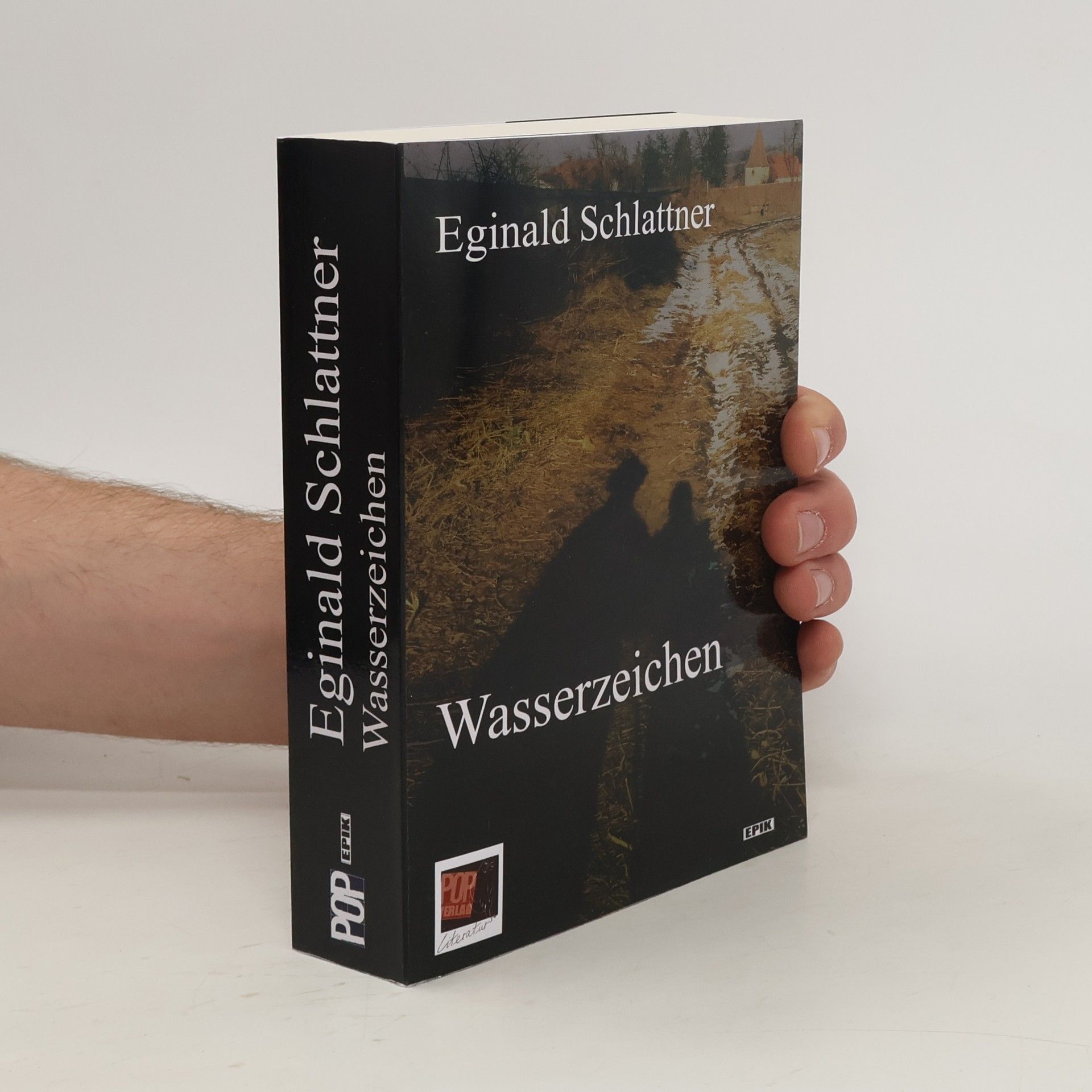Ein Erinnerungsroman von erzählerischer Kraft Ein Fest wird gefeiert in Fogarasch, einer kleinen Stadt im Herzen von Siebenbürgen. Die Freunde des 16jährigen Ich-Erzählers treffen sich im Haus seiner Eltern zum Tanztee. Es soll ein Fest werden zum Schulschluß, es wird ein Abschied für immer. Denn an jenem 23. August 1944 wechselt das mit Hitler verbündete Rumänien die Fronten und schließt sich den Alliierten an. Das jahrhundertelange kultivierte Zusammenleben von Rumänen, Ungarn und Deutschen findet ein Ende. Eginald Schlattners wunderbarer Roman läßt eine den Gefahren trotzende Welt auferstehen - heiter und melancholisch, reich an Details und feiner Ironie, changierend zwischen Realem und Irrealem, aufgezeichnet im Ton zauberhafter Sinnlichkeit.
Eginald Schlattner Bücher




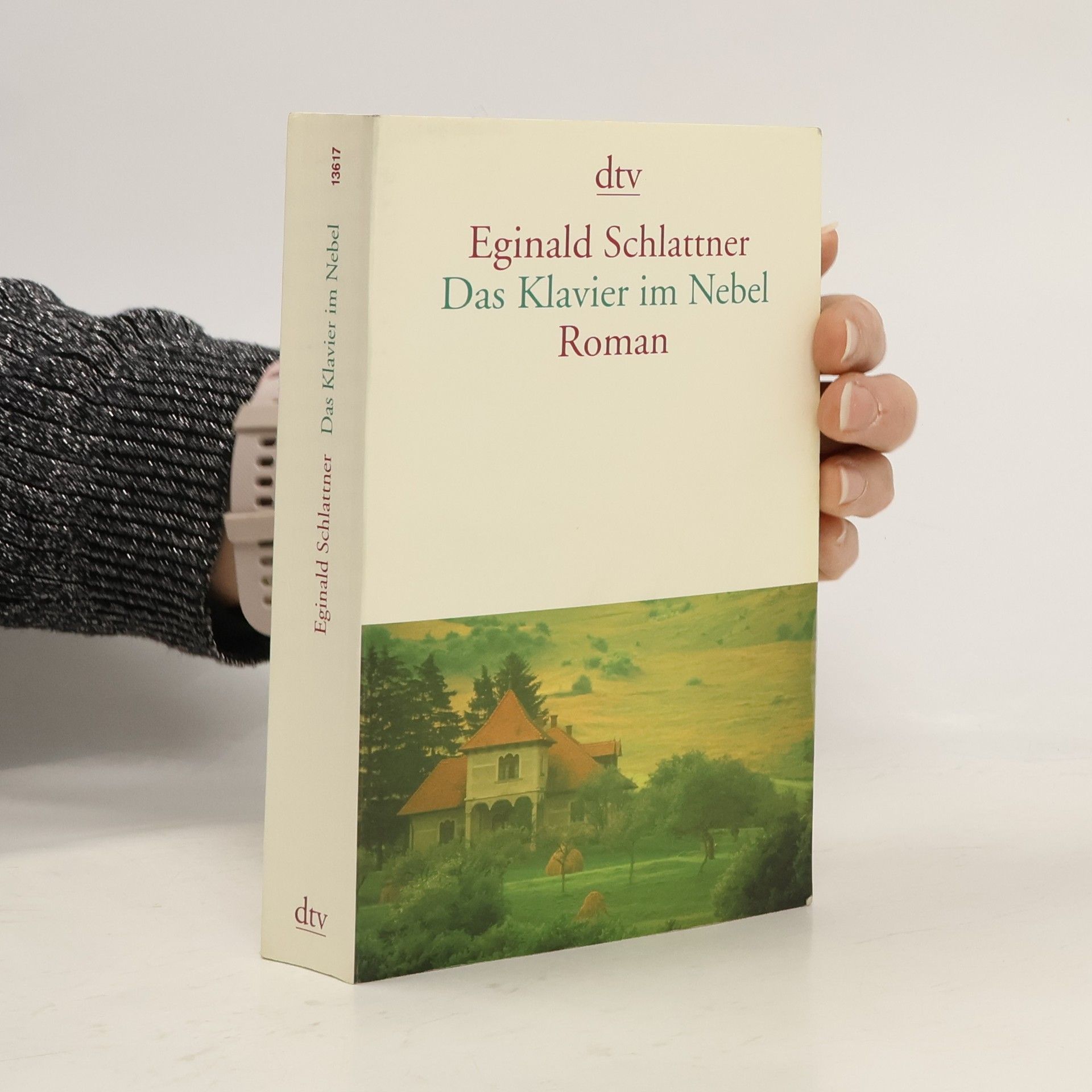
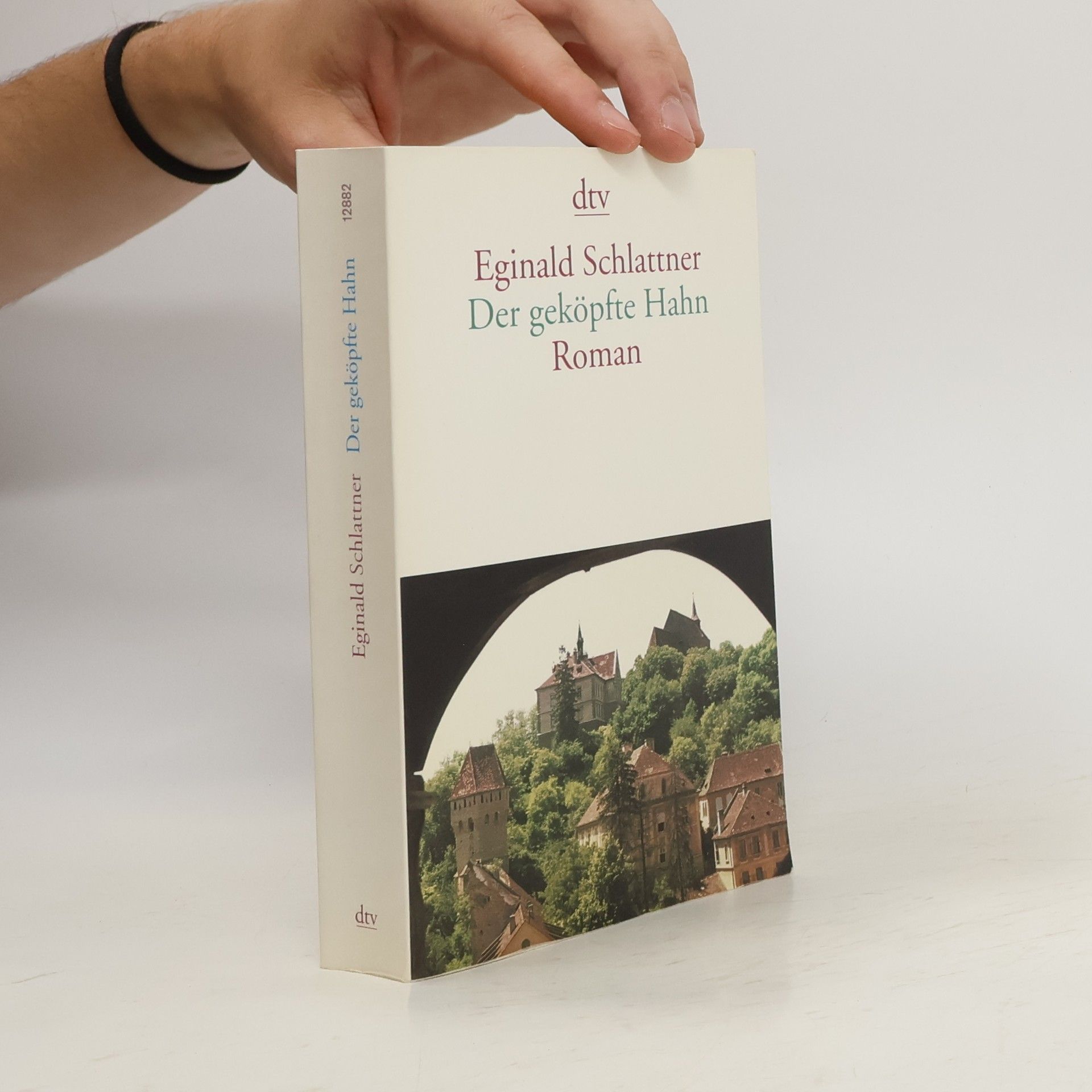
Das Klavier im Nebel
Roman
Die Liebe in Zeiten von Vertreibung und Verbannung Durch die Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg hat die als »bourgeois« verfemte Familie des jungen Fabrikantensohns Clemens aus Schäßburg in Siebenbürgen alles verloren: Die herrschaftliche Villa mußte die Familie räumen, der Vater ist im Gefängnis, die Mutter verschollen. Clemens arbeitet als Schichtarbeiter in der Ziegelei und in der Porzellanfabrik, schlägt sich als Schäfer durch. Es gilt, in den absurden neuen Verhältnissen seinen Platz zu finden.
Rote Handschuhe
- 601 Seiten
- 22 Lesestunden
Verhaftet, verhört, verurteilt. »Ein ganz und gar ungewöhnliches Buch ... Kein in diesem Teil Rumäniens geschriebenes Buch hat bisher so offen und frei von Ressentiments die dortige Nachkriegsgeschichte dargestellt wie die beiden Romane Eginald Schlattners.« Nicole Henneberg in der ›Frankfurter Rundschau‹ Der Ich-Erzähler, Mitte Zwanzig, Student der Hydrologie an der Universität Klausenburg, gerät in die Fänge der rumänischen Staatsmacht. Er wird der Konspiration gegen das kommunistische Regime verdächtigt, Ende Dezember 1957 von der Securitate verhaftet, ins Gefängnis nach Kronstadt gebracht, monatelang verhört, unter Druck gesetzt, seelisch und körperlich mißhandelt und gefoltert. Ein verzweifelter Kampf um Integrität beginnt. Nach dem Debüt-Roman ›Der geköpfte Hahn‹ über seine Kindheit in Siebenbürgen zeichnet Eginald Schlattner im vorliegenden Roman die Tragödie eines jungen Menschen nach, der sich auf der falschen Seite wiederfindet. »Schlattner setzt sich mit dem eigenen Fall auf eine radikal schonungslose Weise auseinander ... sinnlich, bildhaft und deutlich zugleich, ein Meister der Charakterstudie, der bei allem bitteren Ernst einen Sinn fürs Komische und Merkwürdige, für das Ironische des Schicksals hat.« (Daniela Strigl im ›Standard‹)
Das Buch dokumentiert ein Interview mit Eginald Schlattner, das 2017 in Rumänien geführt wurde. Es thematisiert die heutige Bedeutung der Religion, die Beziehungen zwischen den Konfessionen und die Rolle der Sprache für den Fortbestand des Glaubens. Schlattner betont, dass seine Lehren auch nach dem Verschwinden der Siebenbürger Sachsen bestehen bleiben werden.
In diesem Gedächtnisroman reflektiert der Autor über verlorene Menschen und die schmerzhaften Erinnerungen an sie. Er verbindet Biografie mit Fiktion und hinterfragt die Grenzen zwischen Realität und Erinnerung. Eine scheinbar einfache Fahrt wird zum Symbol für den Verlust und das Verweben von Vergangenheit und Gegenwart.
Brunnentore
Roman
Im äußersten Winkel des Obstgartens lag ein Wasserloch, das nie austrocknete. Der Großvater nannte es „blinden Brunnen“, der Vater „Tümpel“ und die Mutter „Weiher“. Für uns Buben war es das Brunnentor in rätselhafte Gründe. Mein kleiner Bruder hatte den Namen ausgebrütet. Der runde Teich war von Erlen und Eschen beschirmt und umrahmt von Dotterblumen, die angeblich vor Gespenstern schützten. Früheste Erinnerungen, geprägt von der kindlichen Neugier, stammen aus der Zeit, als ich noch nicht lesen konnte, aber bereits Ungarisch sprach. Diese Erinnerungen entblättern sich aus den zerfransten Bildern der Vergangenheit und sind überlagert von einer Zeit voller „Unordnung und frühem Leid“. Der Autor, Eginald Schlattner, verhandelt in diesem autofiktionalen Werk seine Kindheit in einer ungarisch geprägten Region Siebenbürgens. Er beschreibt das bunte Alltagsleben mit Eltern, Großfamilie und Freunden, sowie den Einfluss seines jüngeren Bruders Kurtfelix. Die kindliche Perspektive des Ich-Erzählers lässt historische Brüche und Umbrüche anders erscheinen, etwa die staatliche Zugehörigkeit Transsilvaniens oder den aufkommenden Nationalsozialismus. Die Handlung spielt in den späten 30er-Jahren und endet mit dem Wiener Schiedsspruch 1940, als die Familie nach Kronstadt zog. Dieses Werk schließt die letzte autofiktionale „Lücke“ in Schlattners literarischem Schaffen.
Wasserzeichen
Ersonnene Chronik
Von Nonnen und Narren, Ikonen und Namen – eine siebenbürgische Bilderwand, durchscheinend wie Wasserzeichen. Sigrid Löffler äußerte 2001 beim Poetenfest in Erlangen: „Offensichtlich ist die Geschichte der Siebenbürger Sachsen zu Ende. Aber dieses Ende ist in den Romanen von Eginald Schlatter exemplarisch aufgehoben, im Hegel’schen Sinne.“ Denis Scheck in einem Brief, Dezember 2016: „... nach dem, was ich von Eginald Schlattner kenne, darf man von Weltliteratur sprechen.“ Der Verfasser selbst befindet: „Meiner Seele Seligkeit hängt nicht von den Büchern ab. Sondern dass ich Pfarrer bin, als Erstes und als Letztes und manchmal durch und durch. Somit der Imperativ: Verlasse den Ort des Leidens nicht, sondern handle so, dass die Leiden den Ort verlassen.“