Gesellschaft ohne Gnade
Psychoanalytische, philosophische und soziologische Perspektiven
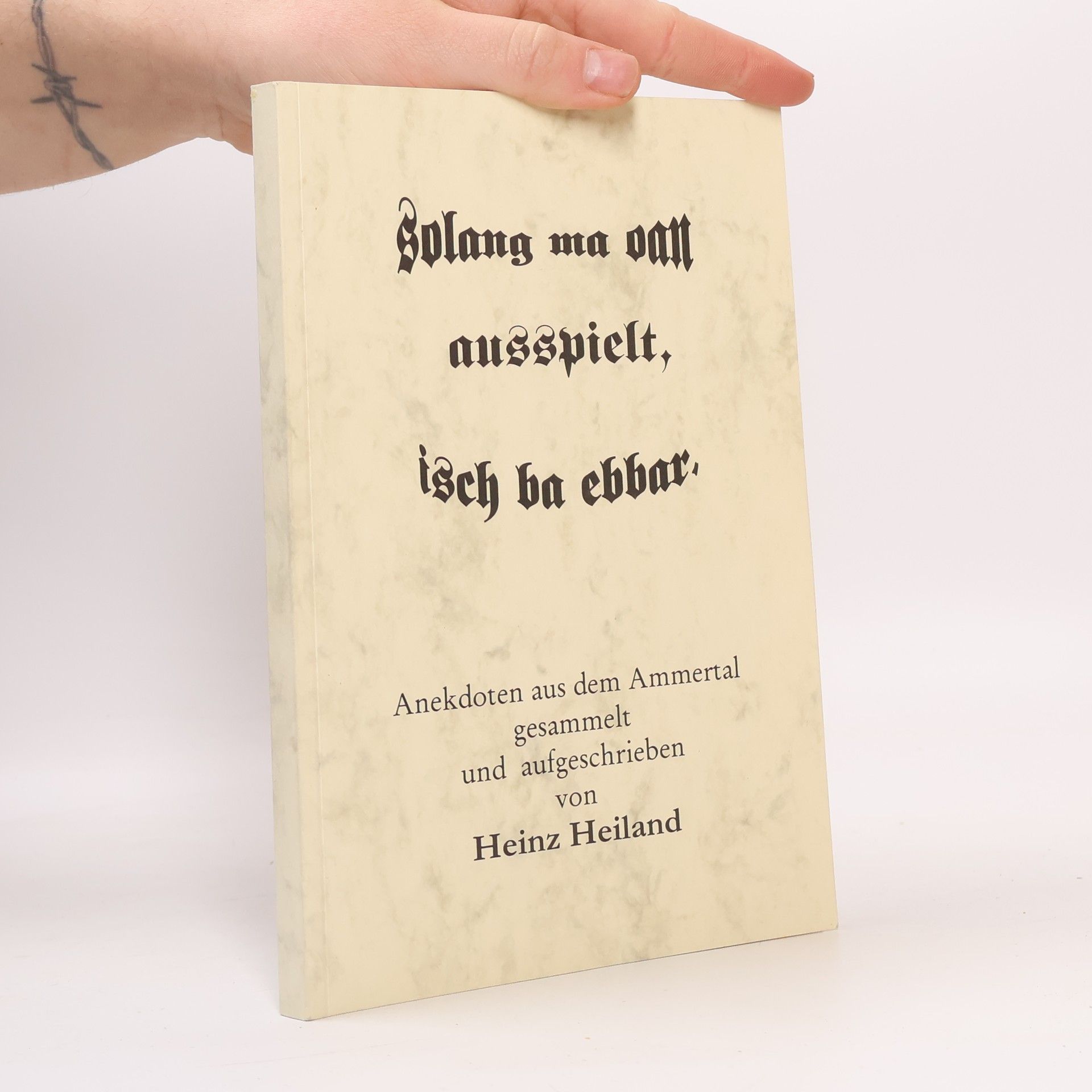





Psychoanalytische, philosophische und soziologische Perspektiven
Kunsttherapie kann die Lebensqualität kranker oder behinderter Menschen erheblich steigern. Sie hilft den Menschen, ihre Ängste und Hoffnungen auszudrücken, sich und ihre Umgebung neu zu erfahren. Häufig wird Kunsttherapie im rehabilitativen Bereich angewandt: nach Unfällen, Traumata, Krebserkrankungen, bei Behinderung und Demenz. Auch bei kindlichen Entwicklungsstörungen lässt sie sich erfolgreich einsetzen. Das Buch stellt die verschiedenen kunsttherapeutischen Verfahren systematisch vor. Es führt in die kunsttherapeutische Praxis ein und veranschaulicht sie mit zahlreichen Bildern und Fallbeispielen. Mit komplett aktualisierten rechtlichen Grundlagen der Berufsausübung, Ausbildungsrichtlinien und zahlreichen Kontaktadressen von Ausbildungsinstituten und Verbänden.
Atmosphärische Übertragung in Gesellschaft, Kunst und Psychoanalyse
Neurobiologische Grundlagen
Das Buch will den Praktiker erinnern: An seine heterogene Herkunft aus ästhetischer Theorie und Psychologie, aus künstlerischer Didaktik und Philosophie, aus den Begreifensweisen der Psychoanalyse. Das Buch versucht den unterschiedlichen Begründungen der Kunsttherapie nachzugehen. Es will die zahlreichen Ansätze kunsttherapeutischer Praxis in ihren Traditionen skizzieren. Das Buch wendet sich an Kunsttherapeuten und Kunstpädagogen.