Zeitspuren
Der KZ-Außenlagerkomplex Allach. Katalog zur Sonderausstellung, 8. Mai 2020 – 13. Februar 2022
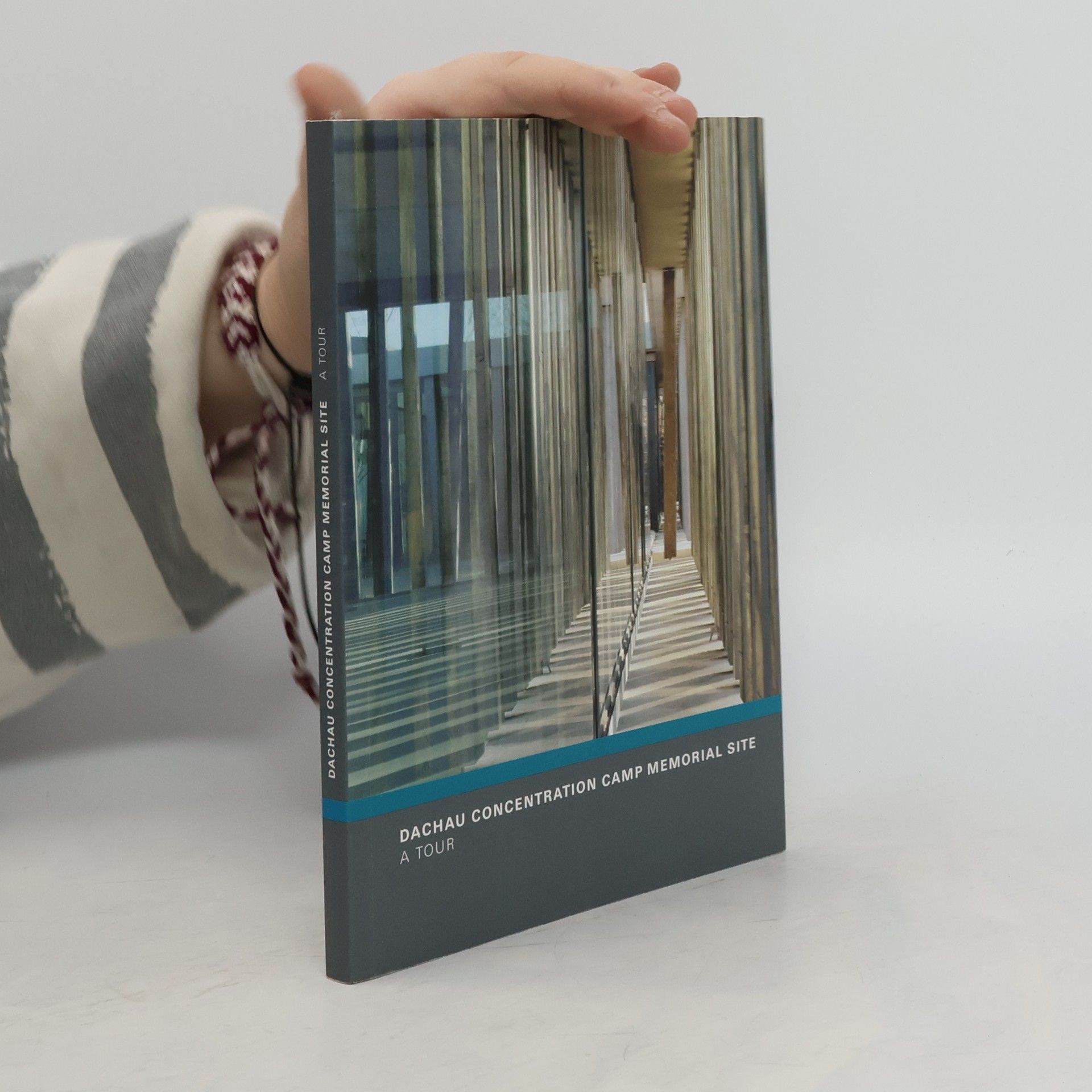
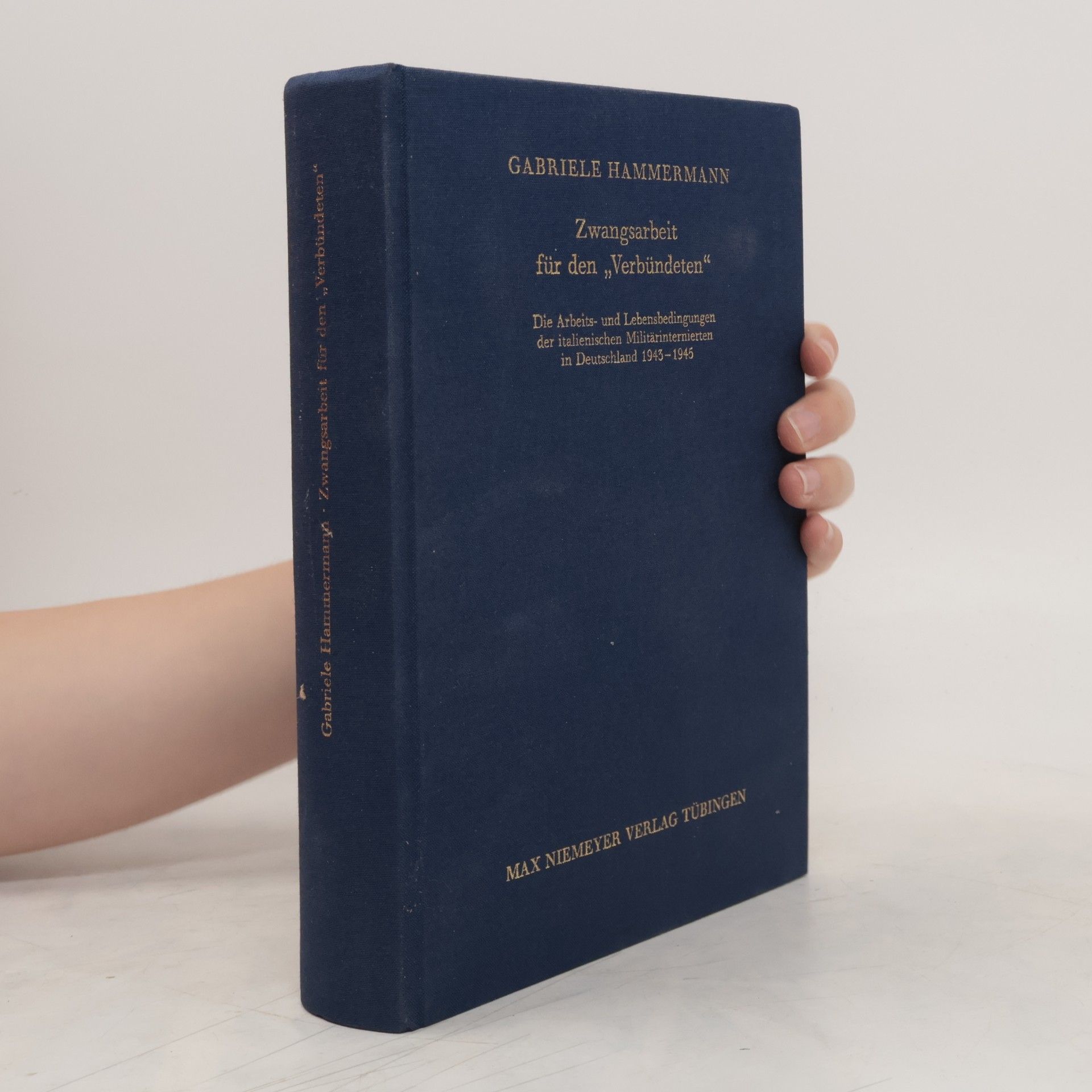



Der KZ-Außenlagerkomplex Allach. Katalog zur Sonderausstellung, 8. Mai 2020 – 13. Februar 2022
Begleitband zur Open-Air-Ausstellung und zur Gedenkinstallation »Ort der Namen«
The tour brochure provides information for visitors to the Dachau Concentration Camp Memorial Site. It guides readers through the grounds and exhibitions in twenty stations, with a further six stations devoted to important locations near the Memorial Site. Based on the latest research and written in a clear and succinct style, the brochure follows the history of the Dachau concentration camp up until 1945 and the subsequent uses of the grounds from 1945 through to the present day. Numerous photographs, some of them historical, as well as drawings and accounts by survivors complement the text. Overview layouts enable visitors to locate different relicts of the concentration camp and places of remembrance. Aerial photographs allow connections to be made between the historical grounds of the concentration camp and today’s Memorial Site. Not only an invaluable aid for a structured exploration of the Memorial Site, the brochure is also ideal for planning and reviewing a visit.
Die Rundgangsbroschüre ist ein Informationsangebot für die Besucher/-innen der KZ-Gedenkstätte Dachau. Sie führt in zwanzig Stationen durch das Gelände sowie die Ausstellungen und in sechs weiteren Stationen durch die Umgebung der Gedenkstätte. In knapper Form vermittelt die Rundgangsbroschüre den aktuellen Forschungsstand zur Geschichte des KZ Dachau und des Ortes von 1945 bis heute. Dabei veranschaulichen zahlreiche aktuelle und historische Fotografien sowie viele Zeichnungen und Berichte von Überlebenden die Darstellung. Mithilfe von Übersichtsplänen lassen sich Relikte des Konzentrationslagers und die Gedenkorte eigenständig aufspüren; Luftbilder stellen einen Bezug zwischen dem Gelände des Konzentrationslagers und der heutigen Gedenkstätte her. Die Rundgangsbroschüre ermöglicht den Besicher/-innen so nicht nur eine strukturierte und zielgerichtete Erkundung der KZ-Gedenkstätte Dachau, sondern sie eignet sich auch ideal zur Vor- und Nachbereitung eines Besuchs.
Am 8. September 1943 erklärte Italien seine bedingungslose Kapitulation gegenüber den Alliierten. In der Folge entwaffneten die Deutschen rigoros die italienischen Streitkräfte im Mittelmeerraum, was der deutschen Kriegswirtschaft Vorteile brachte. Fast 500.000 italienische Soldaten und Unteroffiziere standen nun für die Rüstungs- und Schwerindustrie sowie den Bau und Bergbau zur Verfügung. Sie wurden schnell an den Rand der sozialen Hierarchie gedrängt und waren kaum besser behandelt als „Ostarbeiter“ und sowjetische Kriegsgefangene. Hitler wies ihnen, um dem Bündnis mit Mussolini Rechnung zu tragen, den Sonderstatus der „Militärinternierten“ zu. Gleichzeitig herrschte auf allen politischen Ebenen eine Widersprüchlichkeit: Die Italiener wurden für den als „Verrat“ angesehenen Kriegsaustritt bestraft, während sie gleichzeitig effektiv in der Kriegswirtschaft eingesetzt werden sollten. Dies führte zu einer gravierenden Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen. Erst im Frühsommer 1944 kam es in den Unternehmen und später in der Reichsleitung zu einem Umdenkungsprozess, der im August/September 1944 zur Entlassung der Militärinternierten in das Zivilverhältnis führte. Diese Veränderung brachte jedoch nur kurzfristige Entspannung, bevor sich ihre soziale Realität in den letzten Kriegsmonaten erneut drastisch verschärfte.