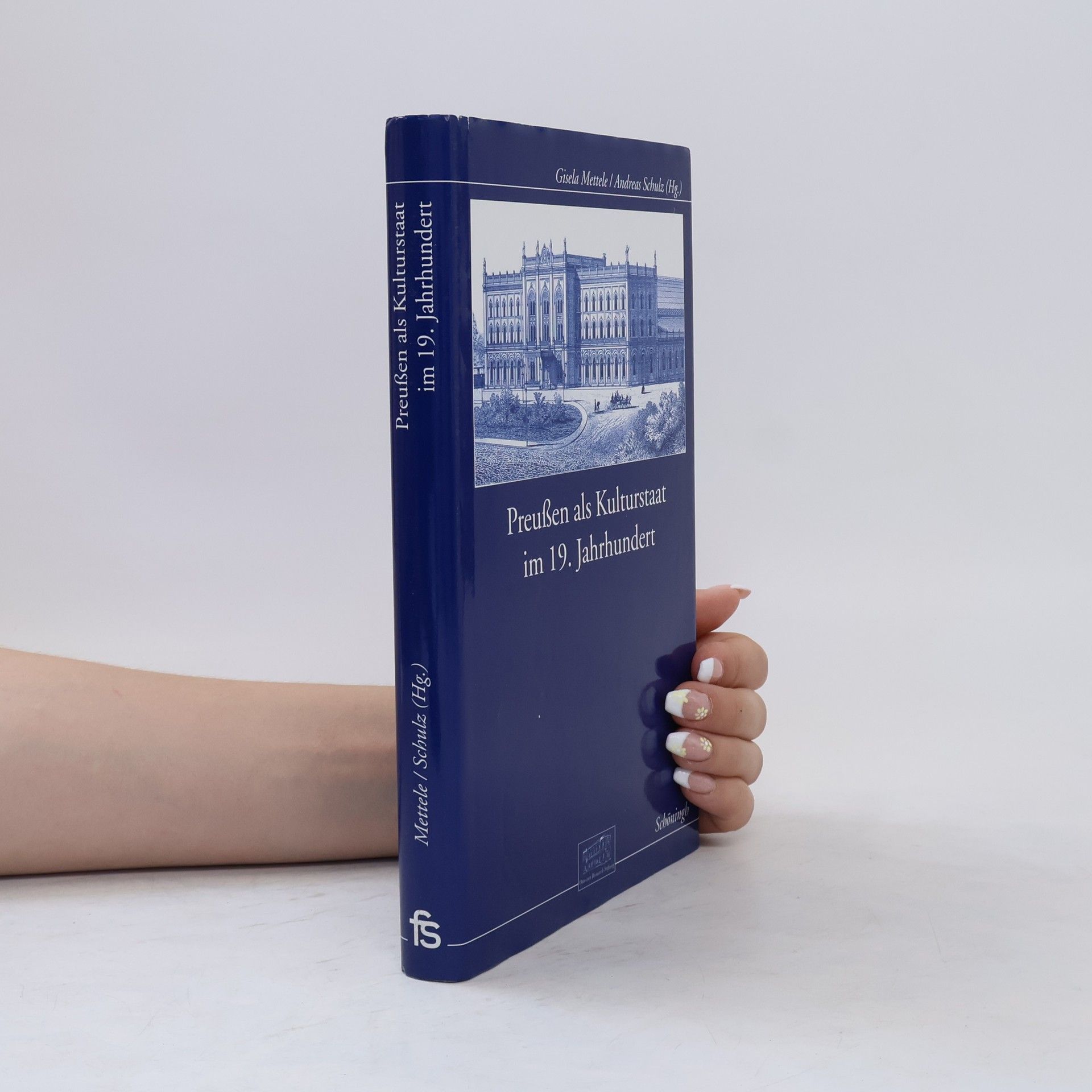Romantische Urbanität
Transdisziplinäre Perspektiven vom 19. bis zum 21. Jahrhundert
- 317 Seiten
- 12 Lesestunden
Auch wenn die grosse Bedeutung des Naturerlebens in der Romantik unbestritten bleibt, lasst sich zeigen, dass neben Natur und Landschaft auch die Stadt einen wichtigen Aktualisierungsraum des Romantischen bildet. Zentrale Elemente romantischer Stadtvorstellungen sind die harmonische Verbindung von Stadt und Land, die Asthetisierung d