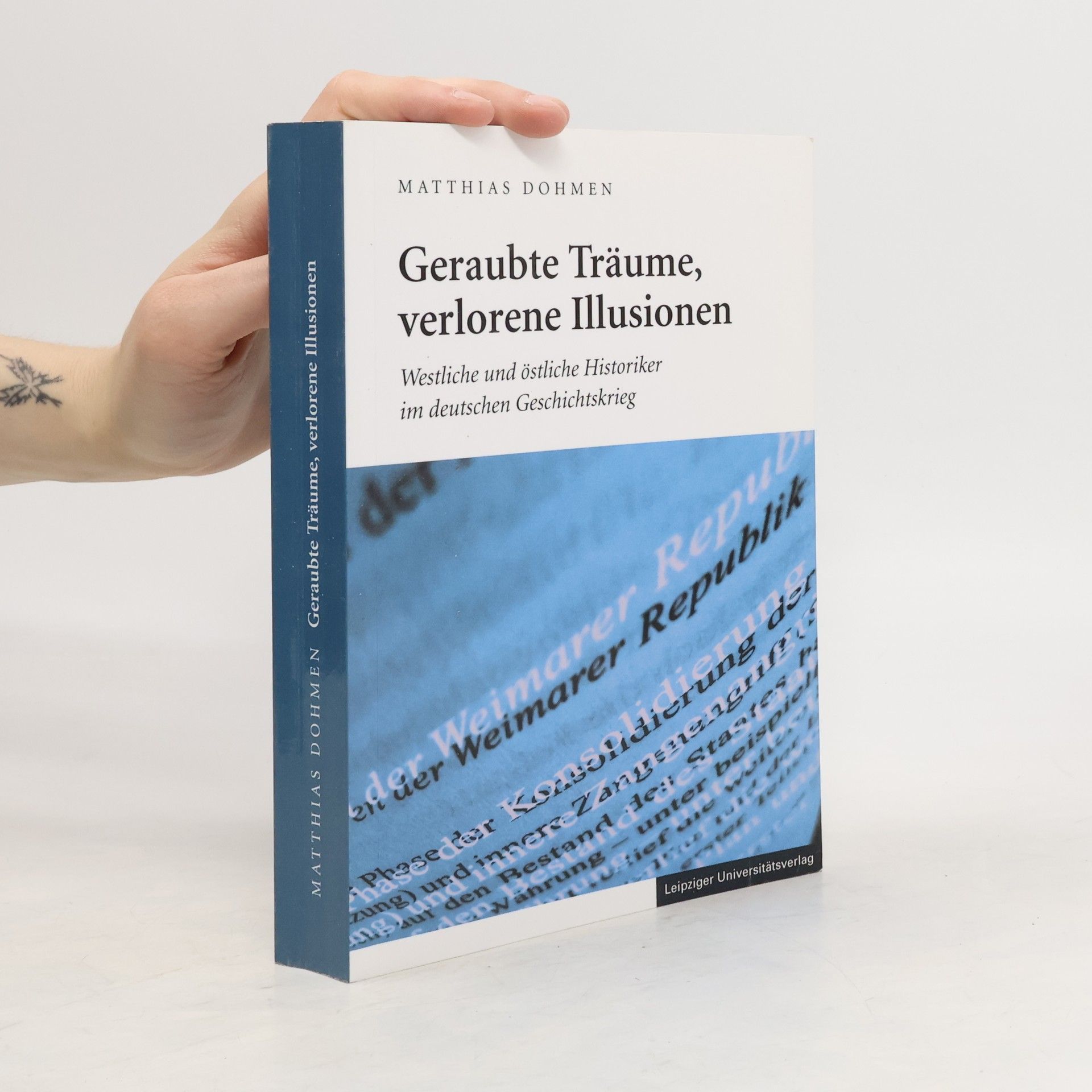Sport - Politik - Heimat
Das Willfried-Penner-Lesebuch
Einblicke in ein aufregendes Leben und in die Geschichte der Bundesrepublik: Willfried Penner hat Weichen gestellt in der alten Bonner und der neuen Berliner Republik. Sozialdemokrat aus Überzeugung, Fußballer mit einem anerkannt wuchtigen Schuss, Ehrenbürger der Wuppermetropole. 28 Jahre im Deutschen Bundestag, immer direkt gewählt. Höhepunkte der Karriere: stellvertretender Minister (Parlamentarischer Staatssekretär) auf der Hardthöhe und Wehrbeauftragter. Er war im Gespräch als BND-Chef und als Bundesanwalt. 2021 wird er 85 Jahre alt. Die Sambatrasse, Rathaus und Sportplätze, La Paz und Harare, immer wieder der Nützenberg sind »Spielorte« des Geschehens. Autoren und Herausgeber sind der Journalist Jochen Macheroux, der Kenner der Bonner und der Berliner Republik Klaus Vater, der »Erfinder« der Junior-Universität, Prof. Dr. h. c. Ernst-Andreas Ziegler, Willfried Penners Mitarbeiter Bettina Petzold und Guido Large sowie Dr. Matthias Dohmen, Historiker, Journalist und Schriftsteller.