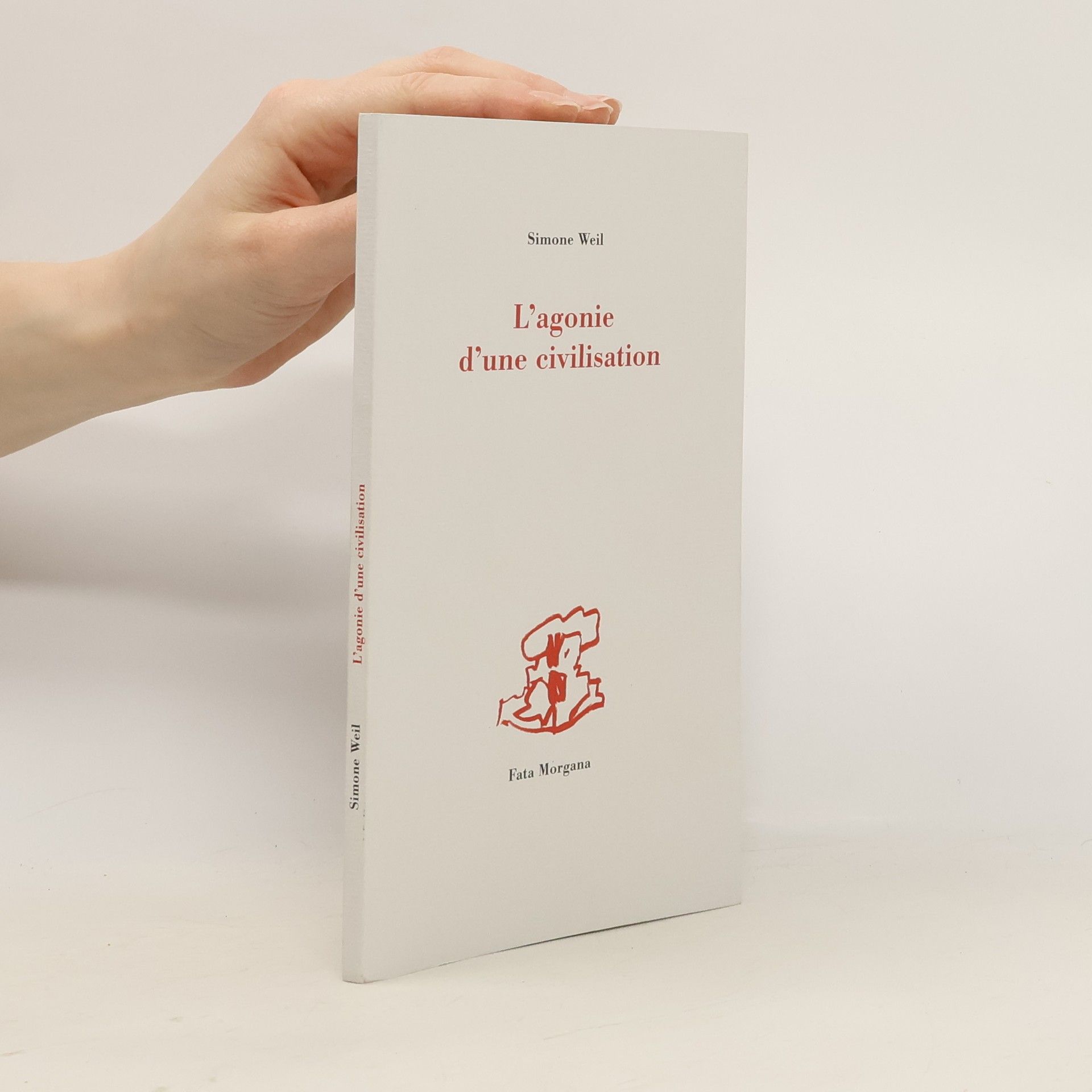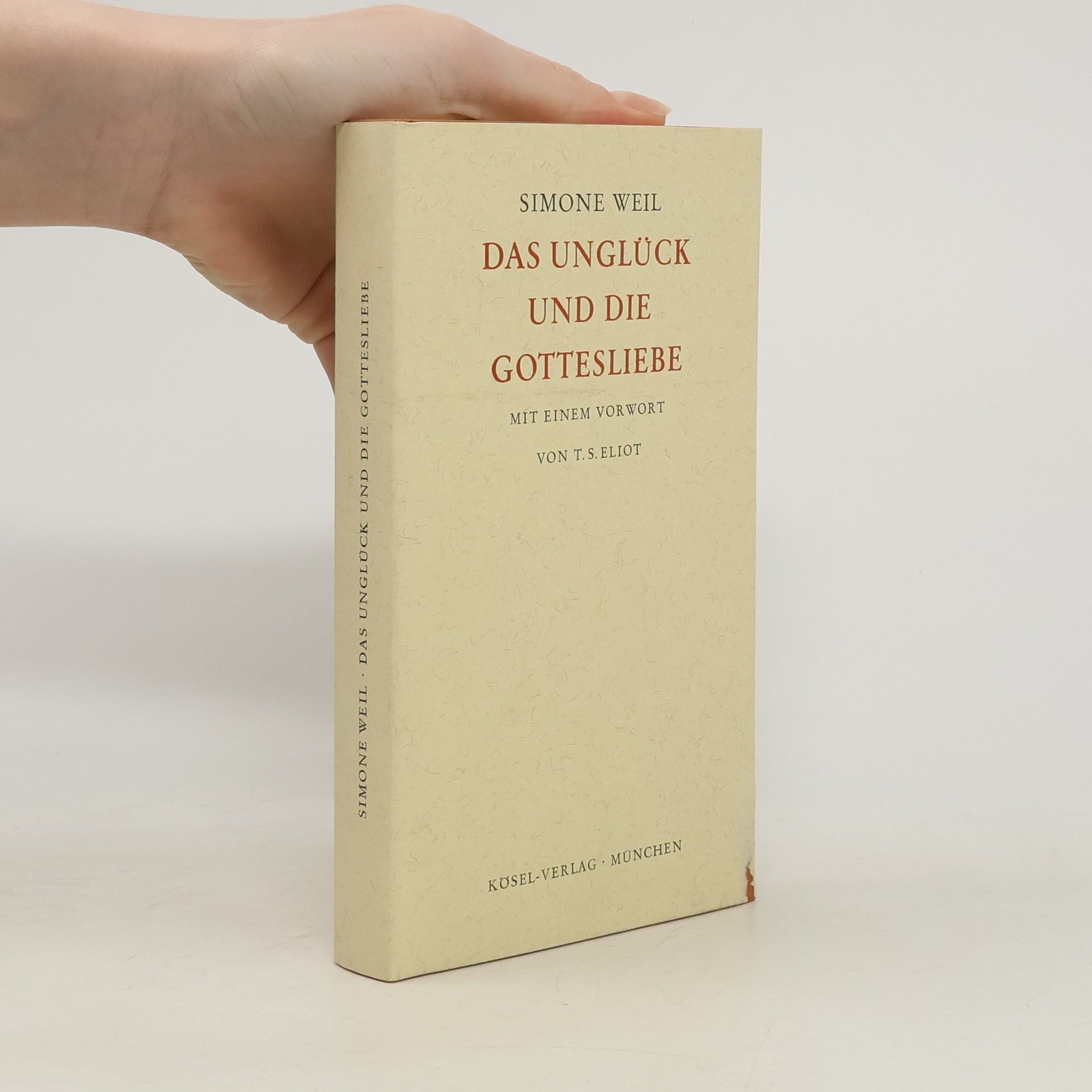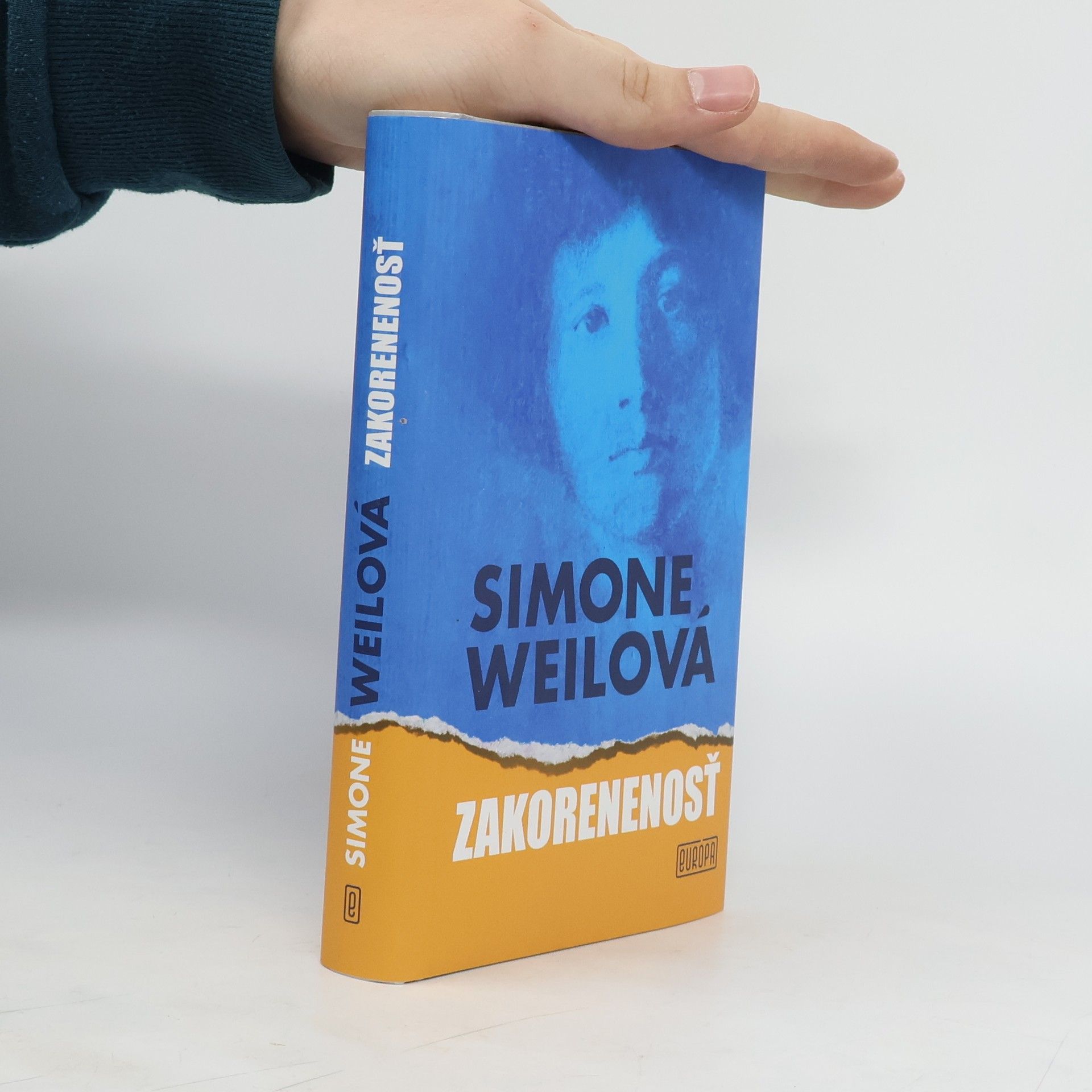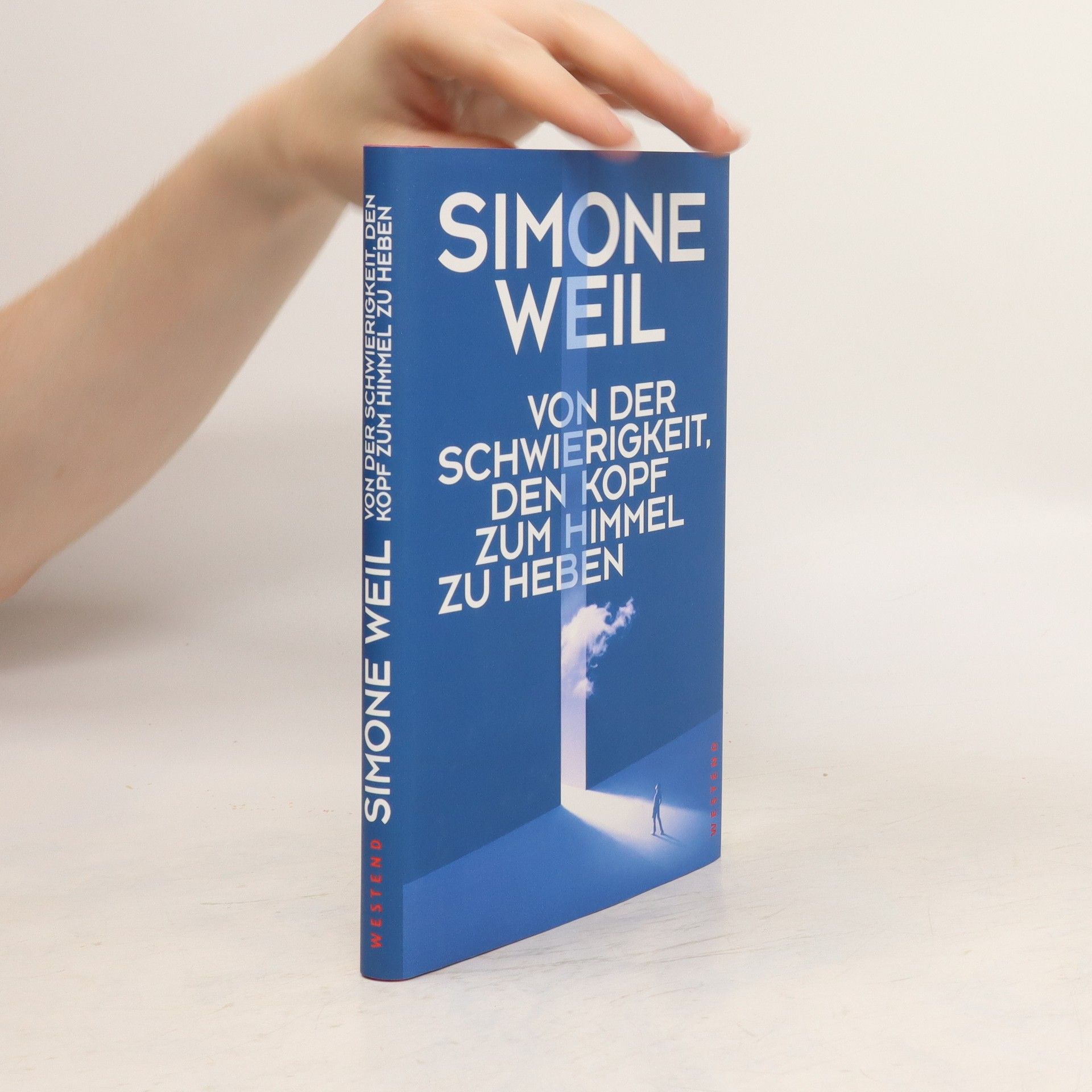Simone Weil Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
Simone Weil war eine französische Philosophin, christliche Mystikerin und soziale Aktivistin. Mit tiefen Einblicken und großer Bandbreite schrieb sie ausführlich über die politischen Bewegungen, an denen sie teilnahm, und später über spirituellen Mystizismus. Ihre kompromisslose Wahrheitssuche und ihr moralisches Genie hinterließen unauslöschliche Spuren in Ethik und Philosophie.







A Life in Letters
- 384 Seiten
- 14 Lesestunden
The collection features the letters of Simone Weil, a philosopher and mystic, offering a unique glimpse into her intellectual journey and personal relationships from childhood to adulthood. Reflecting her experiences amid Europe's turmoil, these letters reveal her evolving thoughts on spirituality, politics, and social justice. Weil's connections with diverse communities and her passion for teaching, poetry, and mathematics are highlighted, alongside her involvement in significant historical events like the Spanish Civil War. An introduction by Robert Chenavier provides context, making this collection accessible to all readers.
Očekávání Boha
- 256 Seiten
- 9 Lesestunden
Tento svazek sestává z dopisů a esejů francouzské filosofky a mystičky Simony Weilové. Představuje pestrost, podnětnost a živost autorčina myšlení, zejména dopisy dávají vhled do autorčina nitra a pohnutého života. Její úvahy nejsou intelektuální cvičení od stolu, ale svědectví z vlastního boje o správný postoj k sobě, druhým, Bohu. V dalších esejích, v nichž se zabývá existenciálním rozměrem víry, Simone Weilová nabízí čtenářům vlastní prožitek víry.
Sie ist erst 33 Jahre alt und wird ein Jahr später sterben, als sie im April und Mai 1942 ihren wichtigsten spirituellen Text verfasst. Das Unglück und die Gottesliebe erschien posthum mit einem Vowort von T.S. Eliot. Das Unglück – in Form von physischem oder seelischem Schmerz, aber auch sozialer Erniedrigung – enwurzelt den Menschen so sehr, dass der von ihm Betroffene das Ganze seines Leben nicht mehr einzuordnen vermag und es als sinnlos empfindet. Um nicht vollständig vom Unglück zerrissen zu werden, muss der Mensch das, was ihm auferlegt ist, annehmen und ihm zustimmen. Dies gelingt ihm jedoch nur dann, wenn er sich etwas Größerem unterordnet. Das kann nur Gott sein, bzw. übernatürliche Liebe. So ist das Mysterium des Unglücks das Erleben einer religiösen Erfahrung und ein mystischer Weg in die Gottesliebe, die ihm verwehrt bliebe, wenn er von sich aus danach strebte, denn das Tor zu Gott ist unmöglich zu öffnen – es sei denn, es wird von innen geöffnet. So braucht es Geduld, um die Erfahrung der Liebe Gottes zu machen, die einem geschenkt oder vorenthalten wird, aber auf keinen Fall zu erwerben ist. Voraussetzung ist das Aufmerken, aufmerksam sein, anderen gegenüber, der Natur, den Armen, den Verstoßenen gegenüber. Aufmerksamkeit ist ein Kraftfeld, in dem das Ich kleiner wird und das Du immer größer. Aufmerksamkeit ist der Weg zu Gott.
Simone Weil: Basic Writings
- 390 Seiten
- 14 Lesestunden
Ideal for newcomers and seasoned scholars alike, this book serves as a comprehensive introduction to Simone Weil's philosophical ideas. It offers insights into her unique perspectives, making it an essential resource for understanding her profound contributions to philosophy.
In Intimations of Christianity Among the Ancient Greeks Weil apply her unique, piercing intellect to early Greek thought, where she finds precursors to Christianity. This Routledge Classics edition includes a new Foreword by Christopher Hamilton.
Zakorenenosť
- 304 Seiten
- 11 Lesestunden
Francúzsku filozofku, mystičku, odborársku aktivistku Simone Weilovú (1909-1943), ktorej celým dielom preniká túžba po „poznaní celou dušou“, označil Albert Camus za „jediného veľkého ducha našej doby“. Filozofia podľa nej „nenapreduje, nevyvíja sa“, to, čo je v nej najpodstatnejšie, je jednota a totožnosť skutočnej múdrosti naprieč časom, čiže dotyk s večnosťou. Preto Weilová môže odmietnuť konceptuálne systematizácie, v ktorých sa skrýva totalitárna a napokon celkom imaginárna ambícia racionality na obsiahnutie celej Skutočnosti. Zakorenenosť, jeden z dvoch najvýznamnejších a zároveň posledný autorkin text, ostal pre jej smrť nedokončený. Ako pri mnohých Weilovej textoch dejinné a politické udalosti slúžia autorke ako východisko a matéria pre filozofickú reflexiu. Z tohto hlbokého, inšpiratívneho diela presvitá Weilovej snaha poskytnúť tým, ktorí budú riadiť povojnovú obnovu Francúzska a určovať jeho ďalšie smerovanie, zreteľné, ušľachtilé a hrubou silou nepoškvrnené kritériá pre vedenie ich pôsobenia. Ich zvrchovanou korunou je pre autorku Boh v zmysle platónskeho Dobra, ktoré jediné môže byť hlavným regulatívom skutočne ľudskej spoločnosti a súčasne predstavuje horizont pre naplnenie a prekročenie individuálnej ľudskej existencie.
Mutig, entschlossen und mit beispiellosem Einsatz kämpfte Simon Weil zeit ihres Lebens für eine bessere Welt. Dabei stellte sie die leidvolle Erfahrung der Fabrikarbeiter und -arbeiterinnen in den Mittelpunkt ihres Engagements. Überraschenderweise steht Weils Vision zur Lösung der sozialen Frage in engem Verhältnis zu Gott. Dabei geht es ihr aber keinesfalls um ein Aufgeben des Weltlichen im Glauben. Die Ordensschwester Britta Müller-Schauenburg beschreibt Weils Haltung in ihrem Vorwort vielmehr als einen „geistlichen Umgang“ mit „geistlosen Routinen“: Fremdbestimmtheit und Sinnlosigkeitsempfindungen, die sich wie die soziale Ungerechtigkeit bis heute weiter ausbreiten. Weils Texte, die jetzt endlich auf Deutsch vorliegen, legen davon ein eindrucksvolles Zeugnis ab.
Simone Weil analysiert die Rolle politischer Parteien als totalitäre Strukturen, die kollektiven Druck erzeugen und ihr eigenes Wachstum anstreben. Sie kritisiert die Entfremdung von Hand- und Kopfarbeit und betont die Bedeutung verantworteter Meinungsäußerung, wie sie in den Cahiers de doléances während der Französischen Revolution zum Ausdruck kam.
En 1933, lors de l'avènement du nazisme en Allemagne, Simone Weil interroge: "Allons-nous vers la Révolution Prolétarienne ? " La célèbre philosophe nous livre dans ce texte sombre ses sentiments sur la période troublée que traverse l'Europe. Simone Weil se penche sur la difficile émancipation des ouvriers face aux régimes bureaucratiques et aux système bancaire. L'URSS de Staline et le fascisme naissant du Troisième Reich se distinguent par leur refus des positions trotskistes. Simone Weil écarte l'idée de défaite d'une internationale des travailleurs, et s'attache dans ce texte rare à trouver du sens à la valeur de la vie humaine .