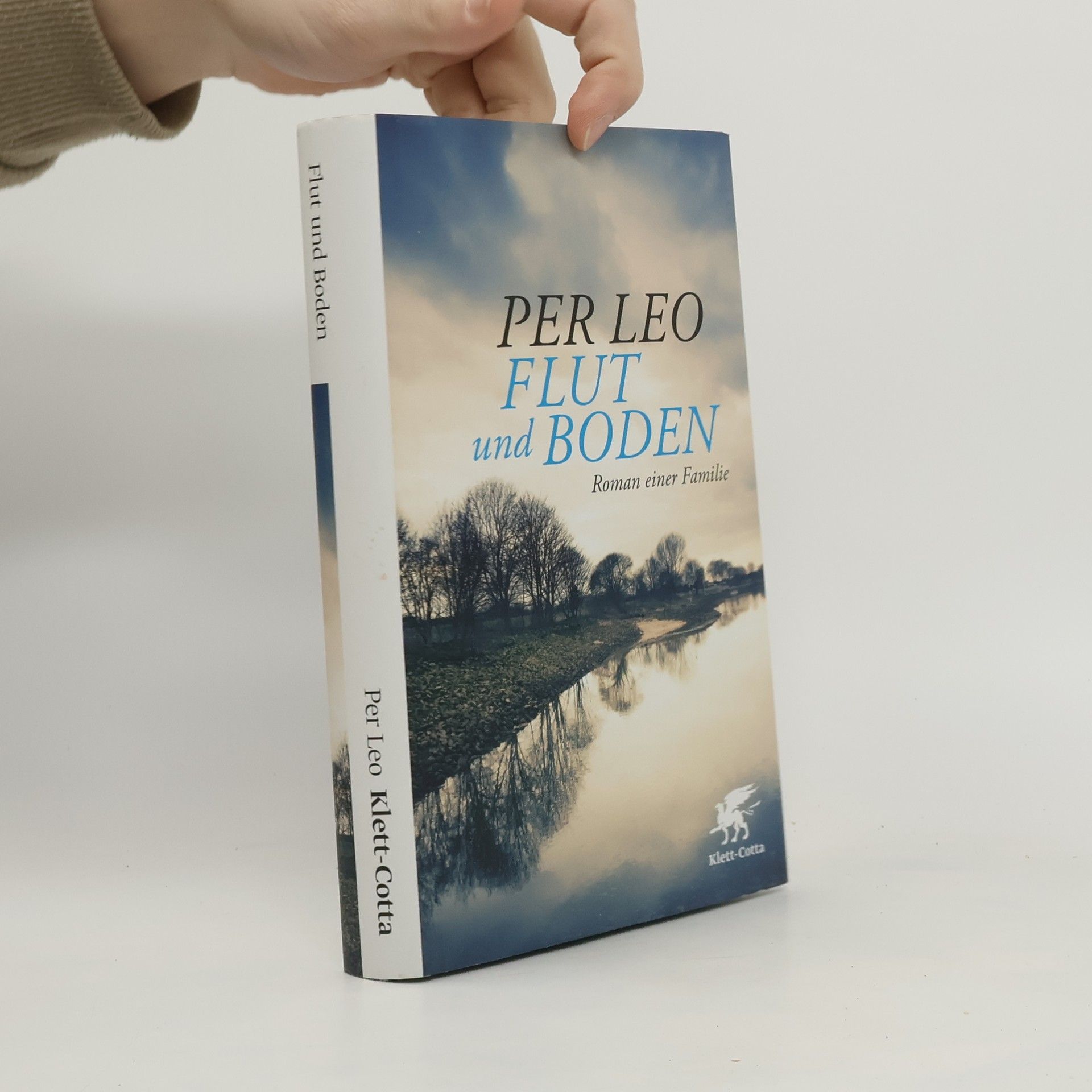Der Wille zum Wesen
- 734 Seiten
- 26 Lesestunden
Per Leo fragt in dieser bahnbrechenden Studie nach den geistesgeschichtlichen Wurzeln von Rassismus und Judenverfolgung im Nationalsozialismus. Er zeigt, dass der Wille zur Ausgrenzung sich weniger als eigenständige Ideologie artikulierte, sondern in eine diffus rationale Weltanschauungskultur eingebettet war, die in dieser Form nur in Deutschland entstehen konnte. Am Beispiel des charakterologischen Diskurses rekonstruiert Leo die Route, auf der das allgemeine Problem menschlicher Ungleichheit und die besondere Frage nach dem »jüdischen Wesen« ihren Weg aus dem 19. ins 20. Jahrhundert fanden. Indem er darstellt, wie ab 1900 die Charakterologie – mit dem Philosophen und Graphologen Ludwig Klages als Leitfigur – zu einem zentralen Orientierungspunkt in der deutschen Geisteslandschaft wurde, ermöglicht Leo auch eine neue Sicht auf die immer noch ungeklärte Frage, wie die deutsche Bildungsschicht im Dritten Reich ankommen konnte. War es nicht möglich, persönliche Individualität ebenso als Charakterform aufzufassen wie rassische Typizität? Musste das »Land der Dichter und Denker« in der Naziherrschaft wirklich untergehen?