Christchurch. IS. "Deutscher Herbst". Chiffren, die wir heute selbstverständlich mit Terrorismus verbinden. Aber was wissen wir über den rechtsterroristischen Attentäter von Christchurch und seine Ideologie? Haben wir uns als Gesellschaft hinreichend für die Betroffenen des islamistischen Anschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz starkgemacht? Und warum liegt die Erinnerung an die Taten der linksterroristischen Roten Armee Fraktion wie ein langer Schatten über dem kollektiven Gedächtnis der Bundesrepublik und prägt bis heute unser Verständnis von Terrorismus? Diese Fragen können nur beantwortet werden, wenn wir uns sehr viel grundsätzlicher mit dem Thema auseinandersetzen: Was ist denn Terrorismus? Wo liegen seine Wurzeln, wie hat er sich im Laufe der Jahrzehnte verändert? Wer wird warum zum Terroristen oder zur Terroristin? Wie lässt sich Terrorismus effektiv bekämpfen? Und wie kann es gelingen, die Opfer stärker in den Blick zu nehmen? Das Zeitbild "Terrorismus im 21. Jahrhundert" geht diesen Fragen nach, ohne einfache Antworten zu geben. Texte und Grafiken, Interviews und Fotos, Porträts und Kartenmaterial ermöglichen ungewohnte Perspektiven, diskutieren aktuelle Kontroversen und machen blinde Flecken sichtbar
Jana Kärgel Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
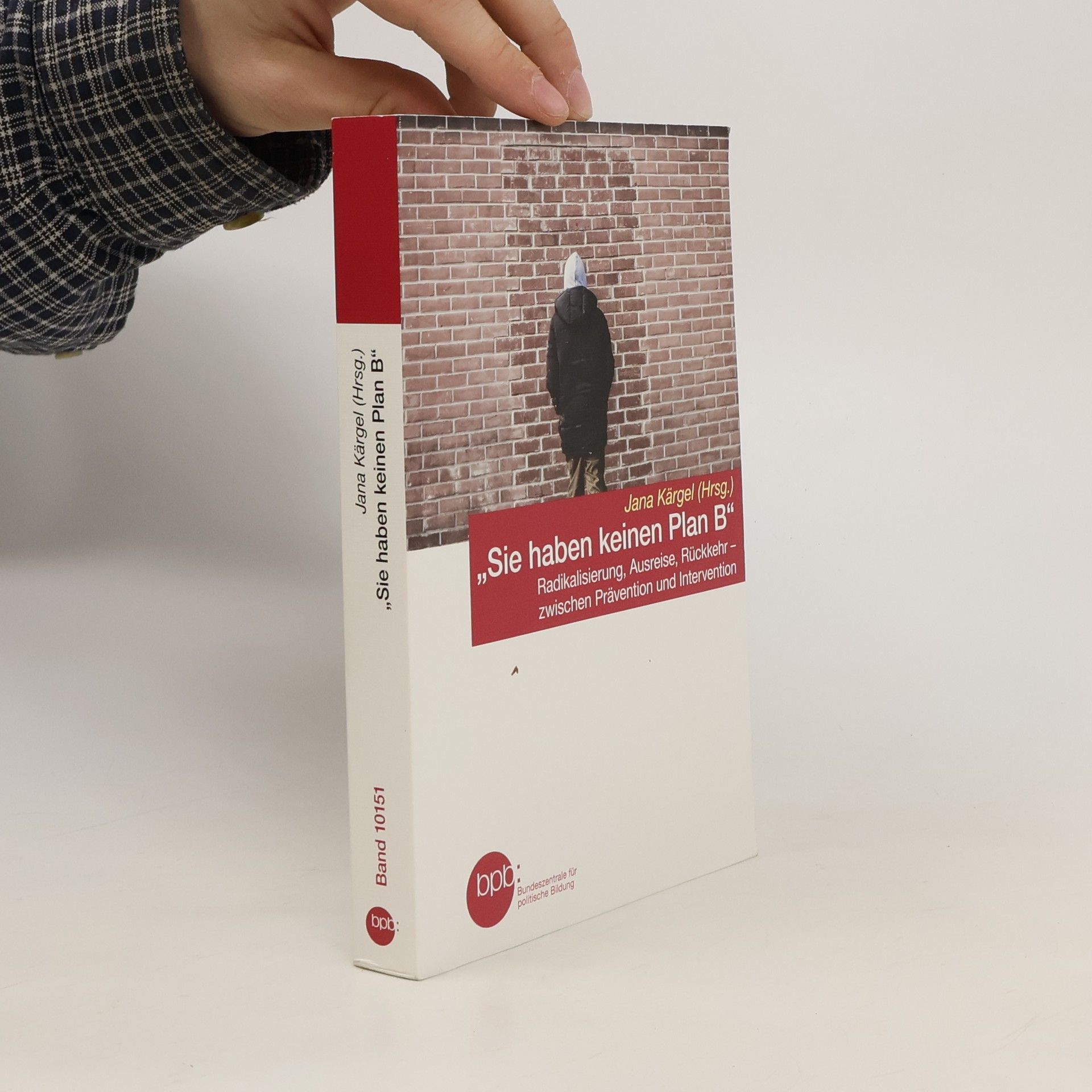
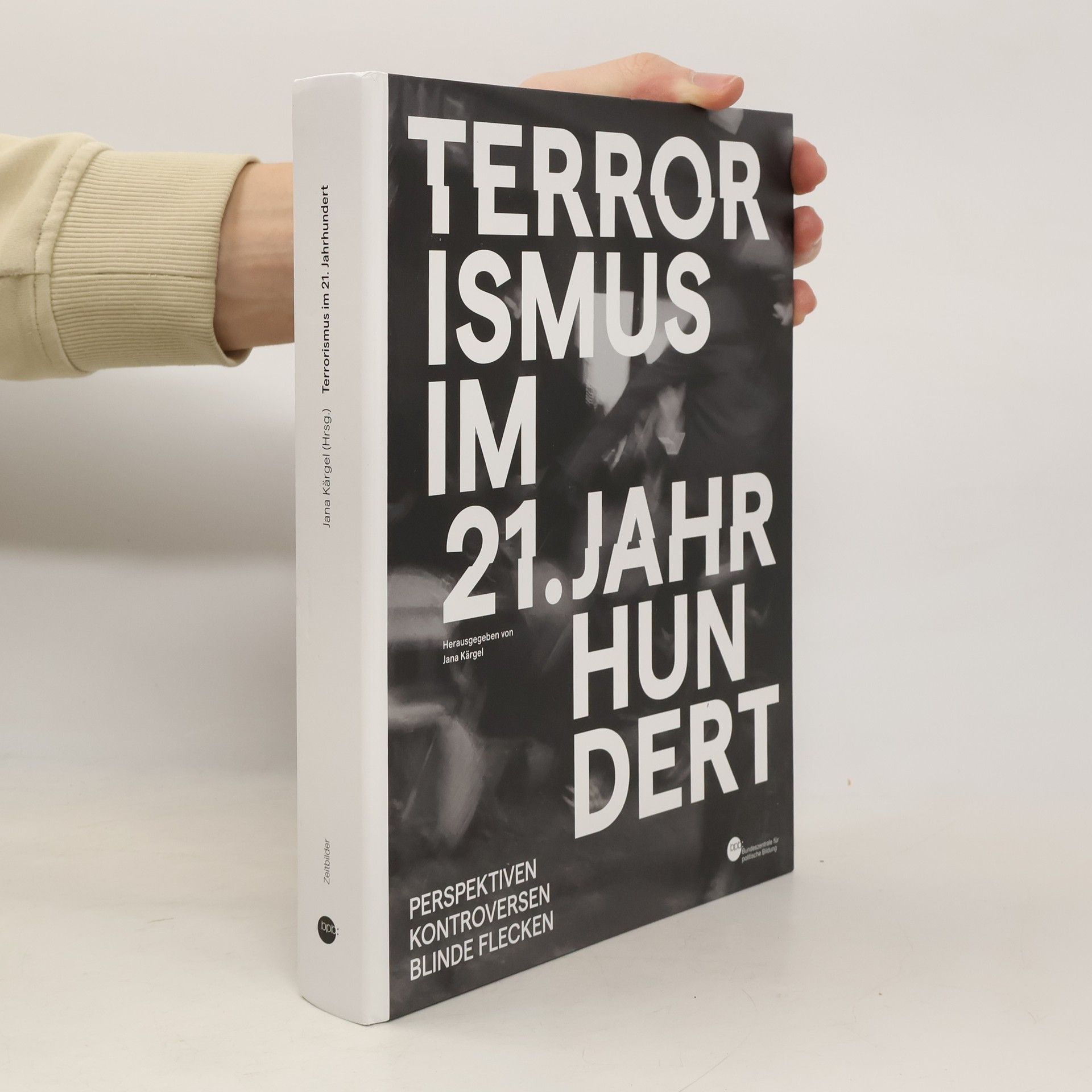
Radikal-islamistische Ideologien sind attraktiv, denn sie versprechen viel: Struktur und klare Regeln, Eindeutigkeit und Zugehörigkeit, Antworten auf die kleinen und großen Fragen des Lebens. Mit ihrer Einteilung der Welt in "Gut" und "Böse", "Freund" und "Feind" suggerieren sie Alternativlosigkeit. Nicht zuletzt deshalb haben viele der jungen Menschen, die sich in den letzten Jahren in Richtung Syrien und Irak aufgemacht haben oder die von dort zurückgekehrt sind, keinen "Plan B" für die Zeit nach ihrer Rückkehr in die Gesellschaft.Dieser Sammelband beschäftigt sich mit der Frage, warum die Auseinandersetzung mit jungen radikalisierten Menschen trotz - oder gerade wegen - dieser Leerstellen und fehlenden Perspektiven wichtig ist und wie diese aussehen kann. Die Autorinnen und Autoren regen dazu an, ein tiefer gehendes Verständnis von Radikalisierung zu entwickeln. Sie laden ein, die Bandbreite der Radikalisierungsprävention kennenzulernen, indem sie aus unterschiedlichsten Perspektiven persönliche Erfahrungen aus der Arbeit mit radikalisierungsgefährdeten und radikalisierten Jugendlichen schildern, von erfolgreichen Projekten berichten und offen über die Fallstricke und Grenzen ihrer Arbeit sprechen.