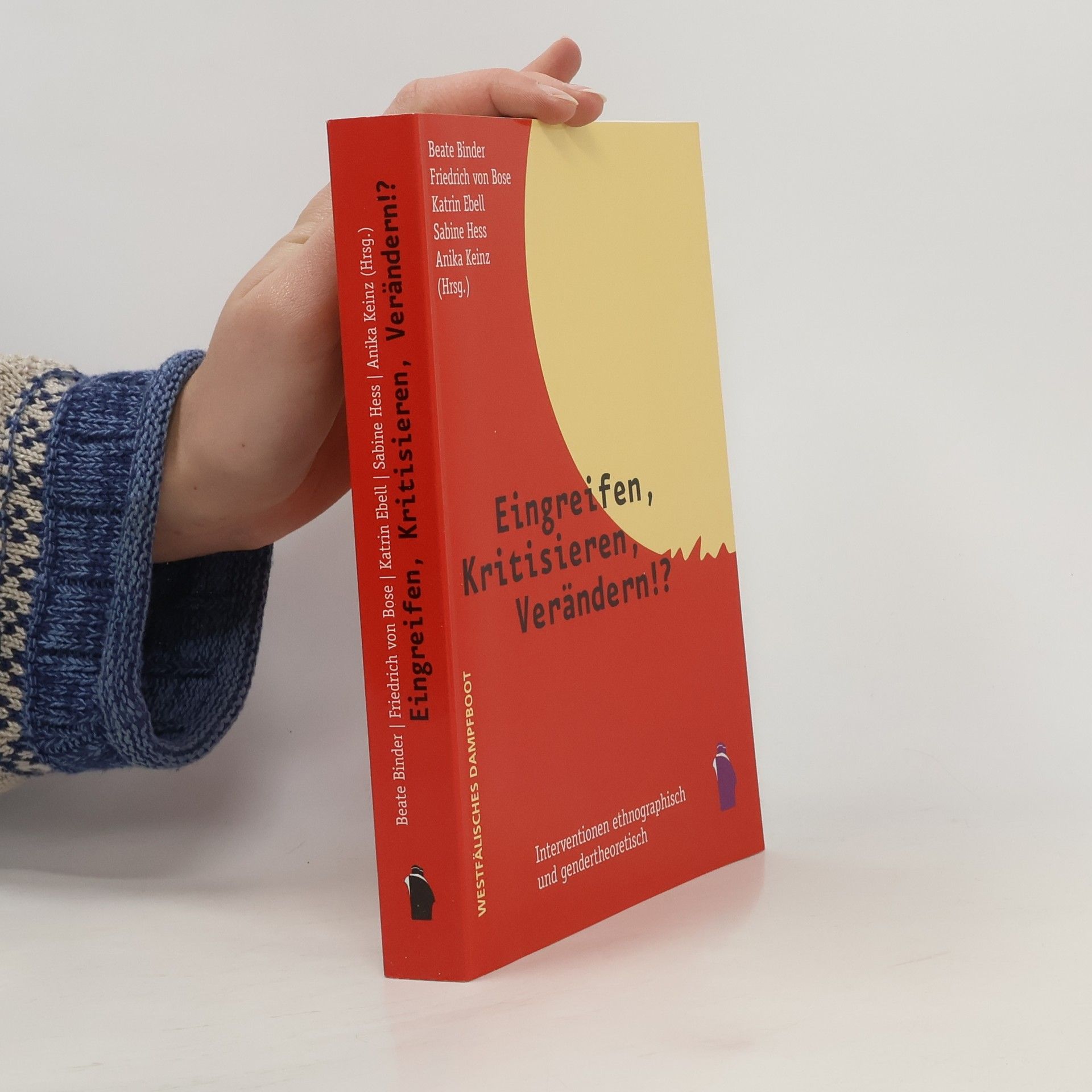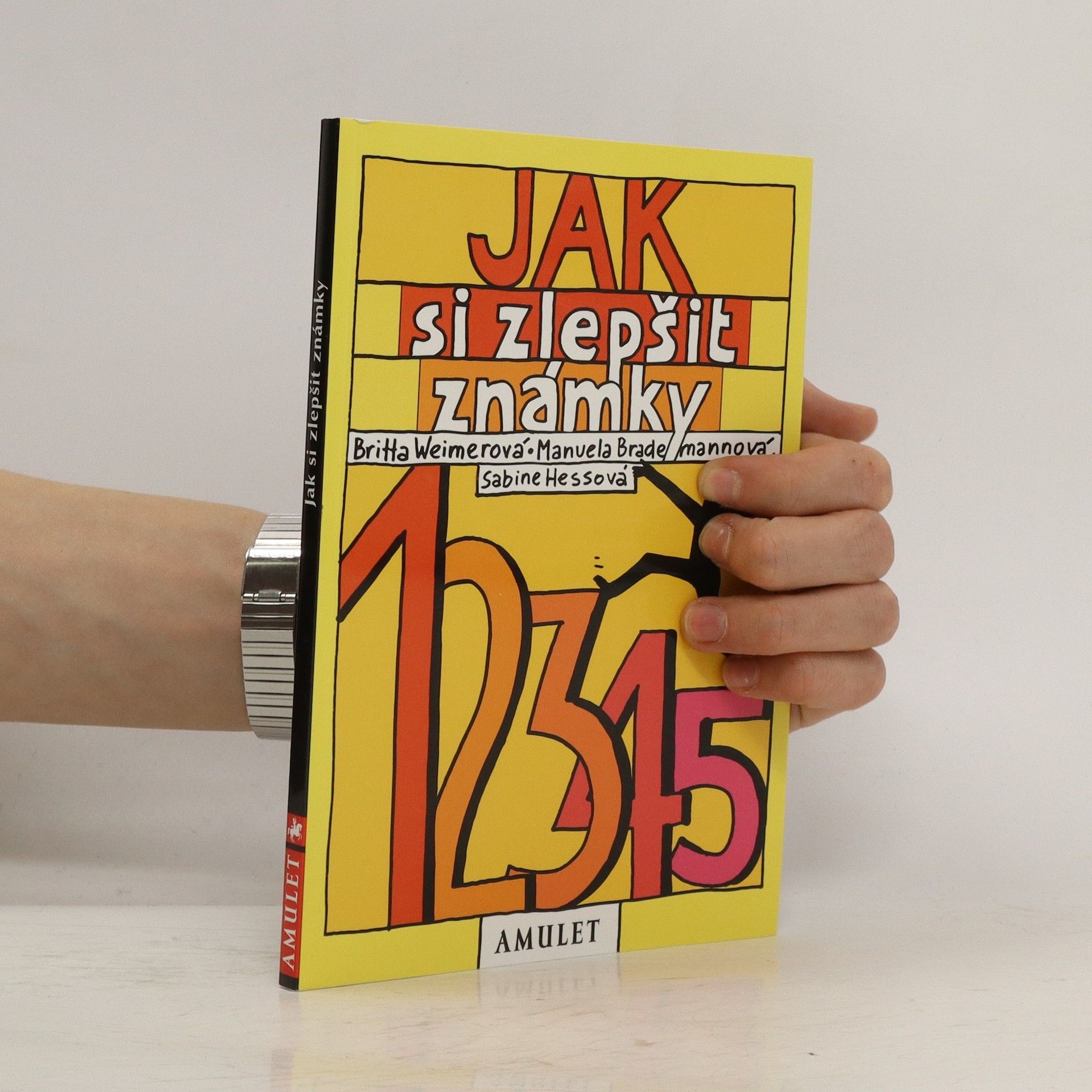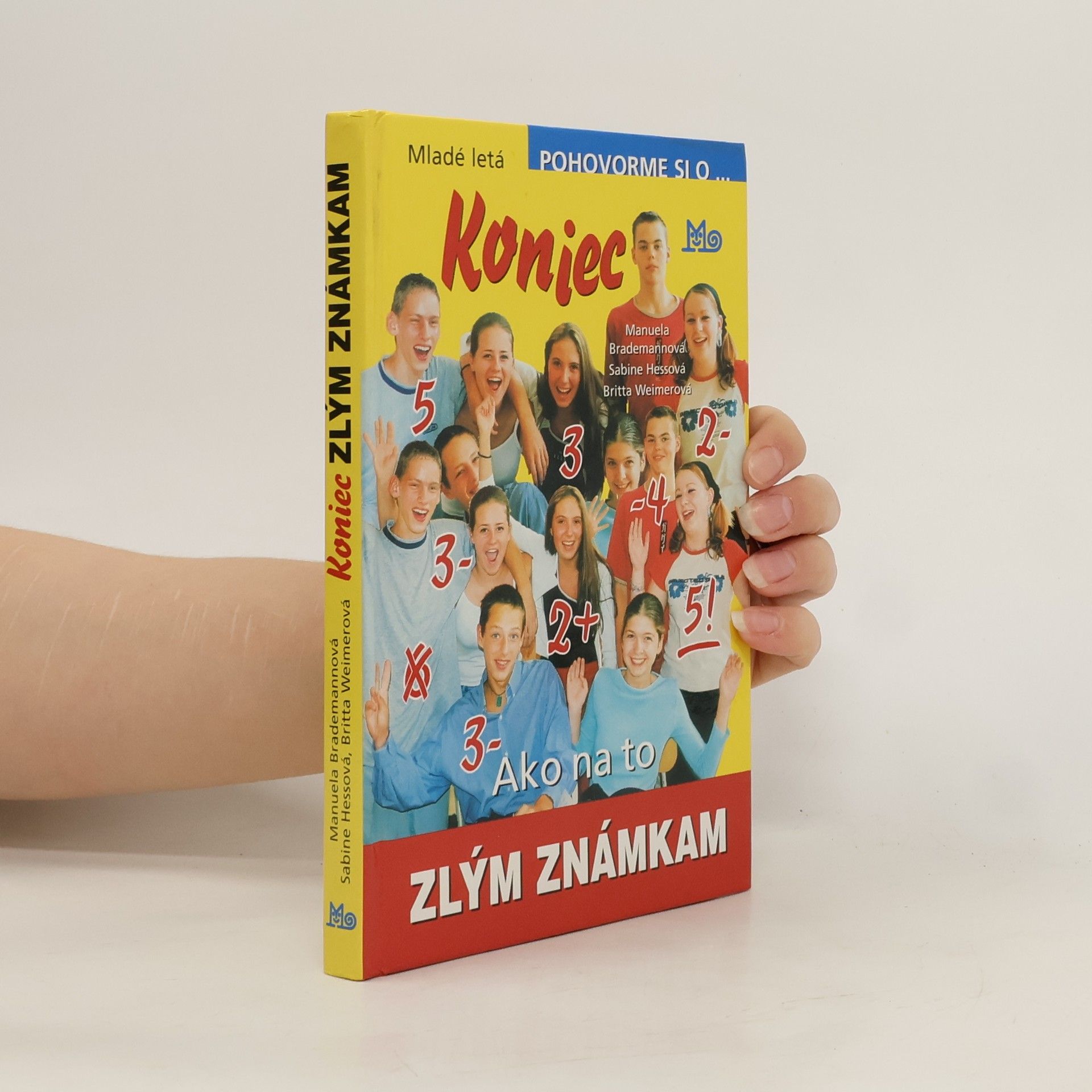Die Kunst des Bittens
Wie du Unterstützung für dein Herzensprojekt findest
Sabine Heß ist seit fast 30 Jahren im Marketing und Vertrieb tätig und hat vor über zehn Jahren ihre Leidenschaft für den gemeinnützigen Sektor entdeckt. Heute begleitet sie Vereine, Stiftungen, Projekte, Initativen und Visionäre im Marketing und Fundraising und stößt dabei immer wieder auf dieselbe Herausforderung: Jedes Projekt kann noch so leidenschaftlich initiiert und jede Vision kann inhaltlich noch so ausgefeilt sein – wenn wir nicht in der Lage sind, die Idee zum richtigen Zeitpunkt bei den richtigen Personen zu platzieren und um Unterstützung zu bitten, werden wir bei der Umsetzung an Grenzen kommen. Die These des Buches: Professionell und gleichzeitig mutig um Unterstützung zu bitten, ist eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt. Wenn wir diese »Kunst des Bittens« aber beherrschen, können wir große Visionen Wirklichkeit werden lassen. Sabine Heß erläutert in ihrem Buch das Potential, das entfaltet werden kann, wenn die richtigen Menschen auf Augenhöhe zusammenkommen. Sie zeigt, wie passende Netzwerke für ein Anliegen identifiziert werden, wie eine optimale Gesprächsvorbereitung und -führung aussieht, welche Skills wir benötigen, wenn wir andere um Unterstützung bitten, und wie wir langfristige Beziehungen aufbauen können.