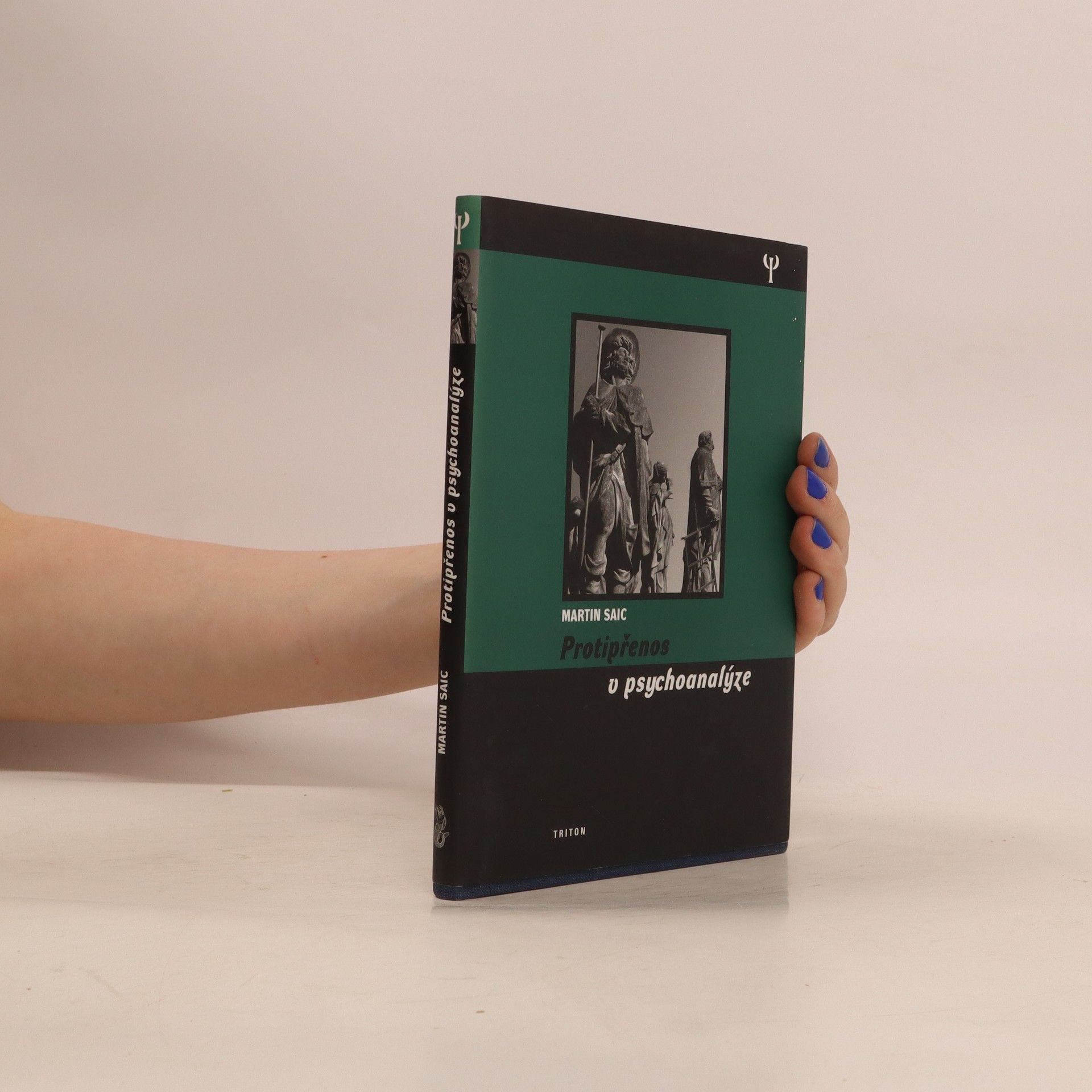MARTIN Bücher
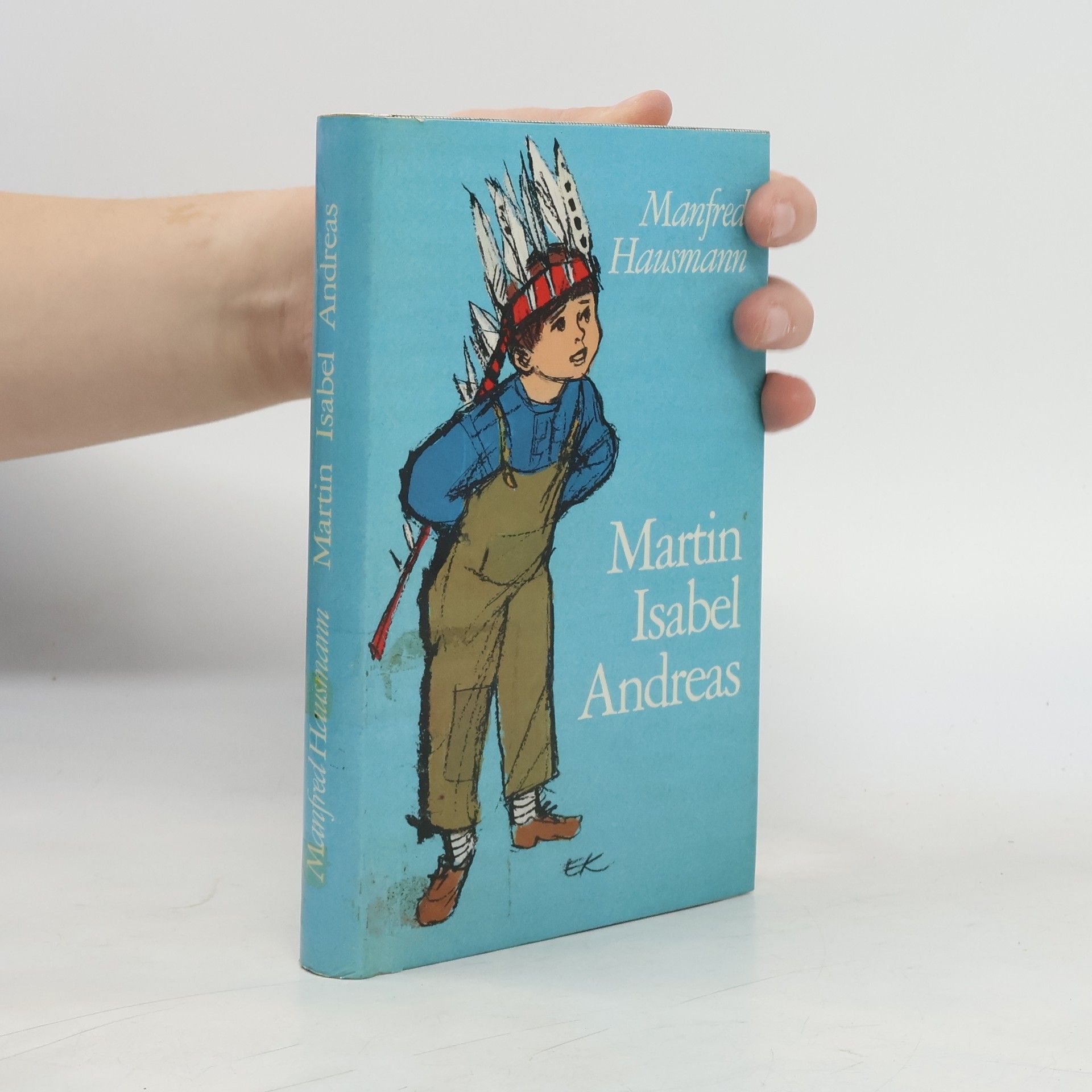
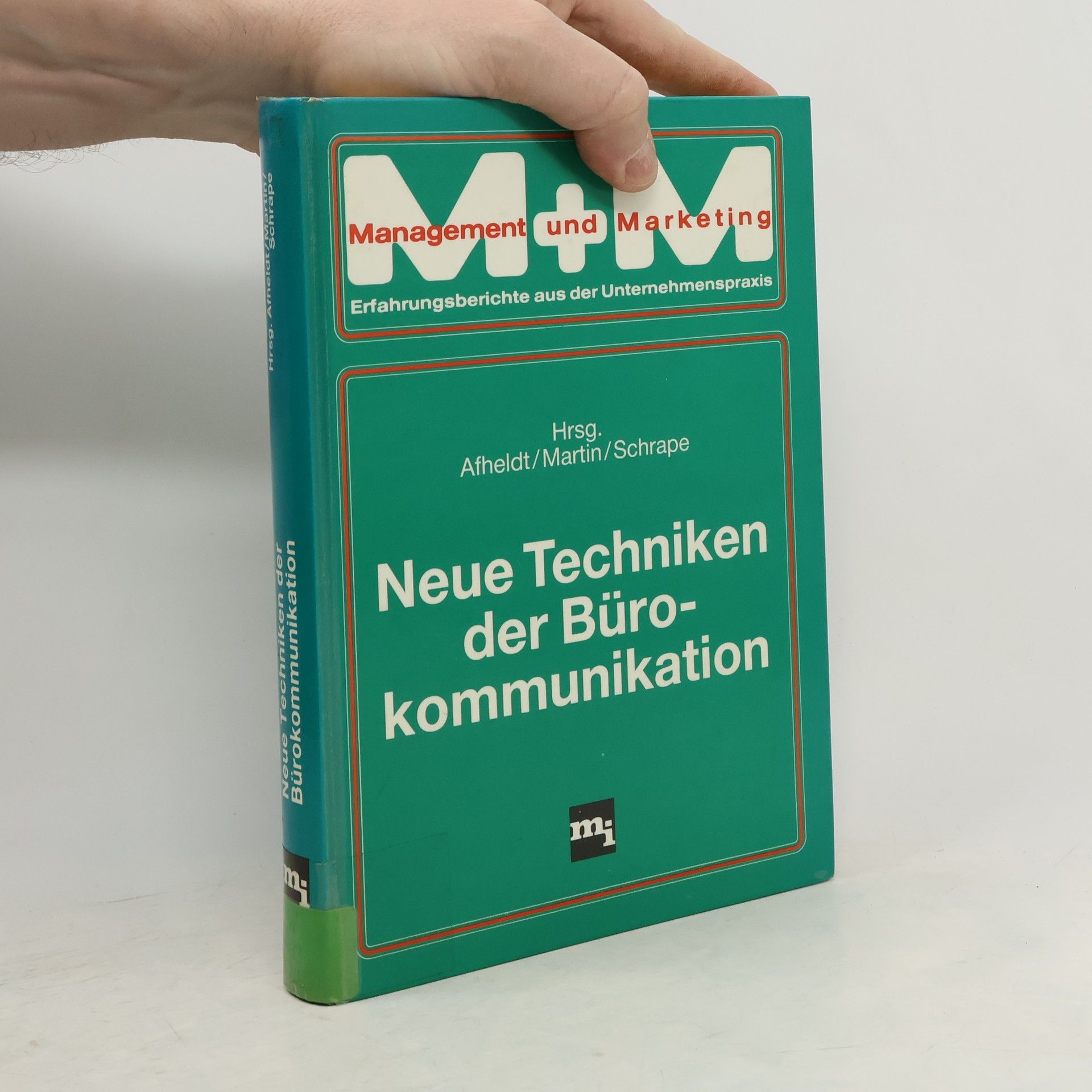



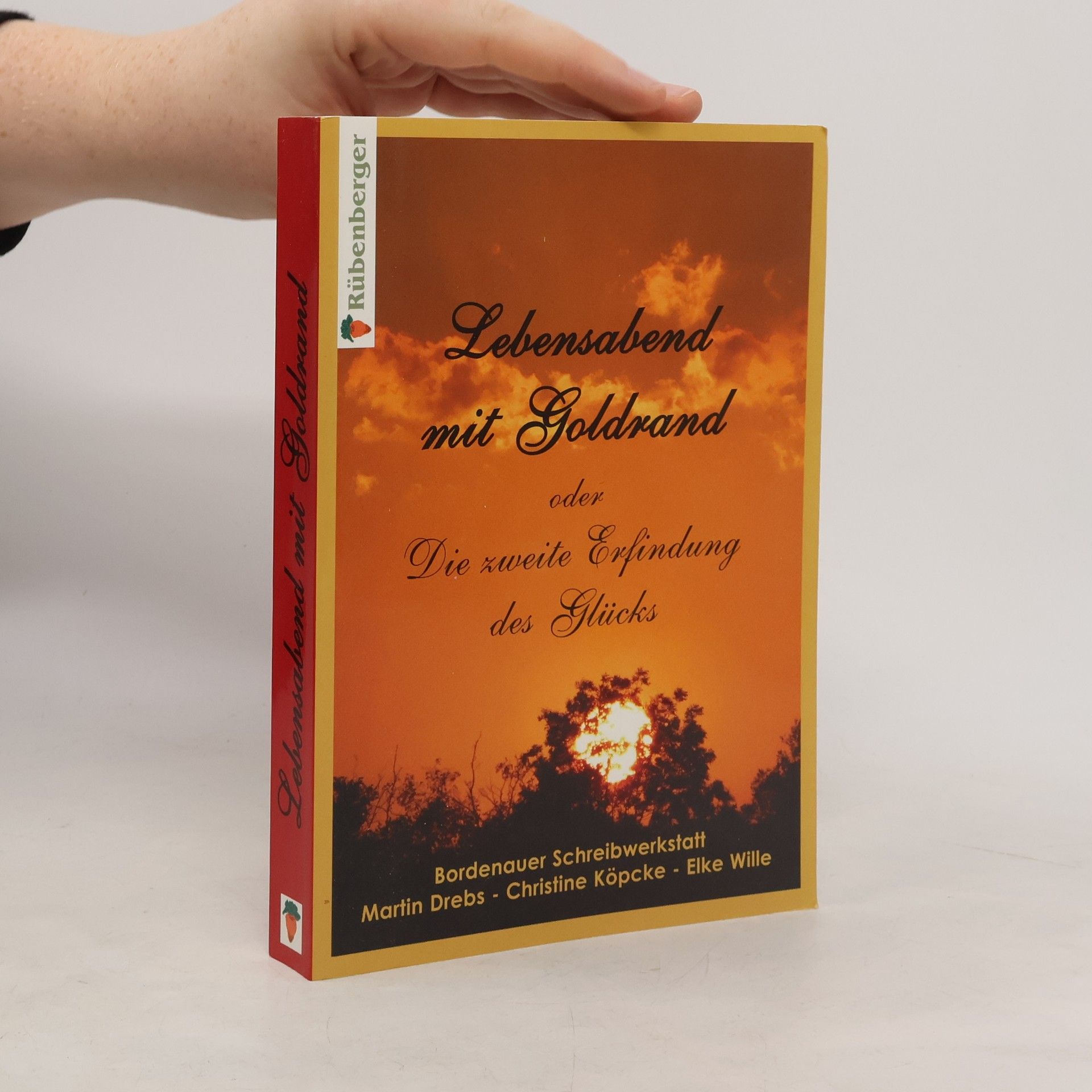
Digitalisierung von Gegenmacht
Gewerkschaftliche Konfliktfähigkeit und Arbeitskampf heute
Die deutschen Gewerkschaften sind massiv von den Auswirkungen der Digitalisierung der Arbeitswelt betroffen. Ihre Organisations- und Durchsetzungsfähigkeit wird ebenso strapaziert wie ihr Anspruch auf eine möglichst umfassende Repräsentation der lohnabhängig Beschäftigten und Arbeitenden. Vor diesem Hintergrund diskutieren die Beiträger*innen die theoretischen Möglichkeiten und praktischen Erfahrungen mit der Digitalisierung von Gegenmacht aus gewerkschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Perspektive. Dazu gehören u. a. Formen des Arbeitskampfes im digitalen Sektor und neue, widerständige Praktiken im Internet oder in der digitalen Infrastruktur von Unternehmen und Konzernen.
Das Chili Handbuch
Chili, Peperoni & Paprika anbauen, vermehren und verarbeiten (Buch über Chilis)
Neue Techniken der Bürokommunikation
- 261 Seiten
- 10 Lesestunden
Tactics of the Ego
- 135 Seiten
- 5 Lesestunden
The ultimate on-the-spot resource, this volume features authoritative yet concise guidelines on pathophysiology, clinical signs, diagnosis and management of all internal medicine disorders. Expanded treatment is given to algorithms and diagnostic decision trees. Two-volume set. 1,500 illustrations, 200 in full color.
Enterprise Java Programming with IBM WebSphere - Second Edition
- 688 Seiten
- 25 Lesestunden
This comprehensive guide is essential for building mission-critical enterprise systems using J2EE, WebSphere, and WebSphere Studio Application Developer. Updated for Versions 5.x, it merges expert architectural best practices with a case study that illustrates the construction of an entire system. The authors, a team of WebSphere insiders including developers and consultants, provide invaluable insights into WebSphere's APIs in real-world scenarios, offering systematic guidance for delivering high-performance, robust systems with significant business value. Key topics include practical introductions to J2EE and WebSphere Application Server 5.0, detailed coverage of web application construction, and MVC partitioning with Struts, servlets/JSP, and session management. The book provides step-by-step instructions for building and testing application business models, including JUnit testing, and offers in-depth insights into EJB architecture, covering transactions, security, and advanced object-relational mapping. Additionally, it explores web services with examples and best practices utilizing the latest enhancements of WebSphere Application Server 5.x. Included are CD-ROMs featuring trial versions of IBM WebSphere Studio Application Developer, IBM WebSphere Application Server, and DB2 Universal Database, along with source code for the case study examples presented in the book.
Psychoanalytikovy pocity, představy a prožitky při terapii jsou dnes považovány za možný zdroj poznatků o tom, co se odehrává ve vnitřním světě pacienta. Současná psychoanalytická teorie pokládá reakce psychoanalytika na pacienta za další královskou cestu do pacientova nevědomí. Tato cesta však skrývá nebezpečí - postřehl je již Sigmund Freud a prohlásil proto protipřenos za překážku psychoanalýzy. Teprve po smrti Sigmunda Freuda se psychoanalytici odvážili uvažovat o protipřenosu také jako o přirozeném a nutném jevu doprovázejícím psychoanalytickou léčbu, který může být nejen překážkou terapie, ale i prostředkem porozumění pacientovi. Tato kniha ukazuje, jak probíhal vývoj od úplného odmítání tohoto fenoménu až k nekritickému postoji k němu.