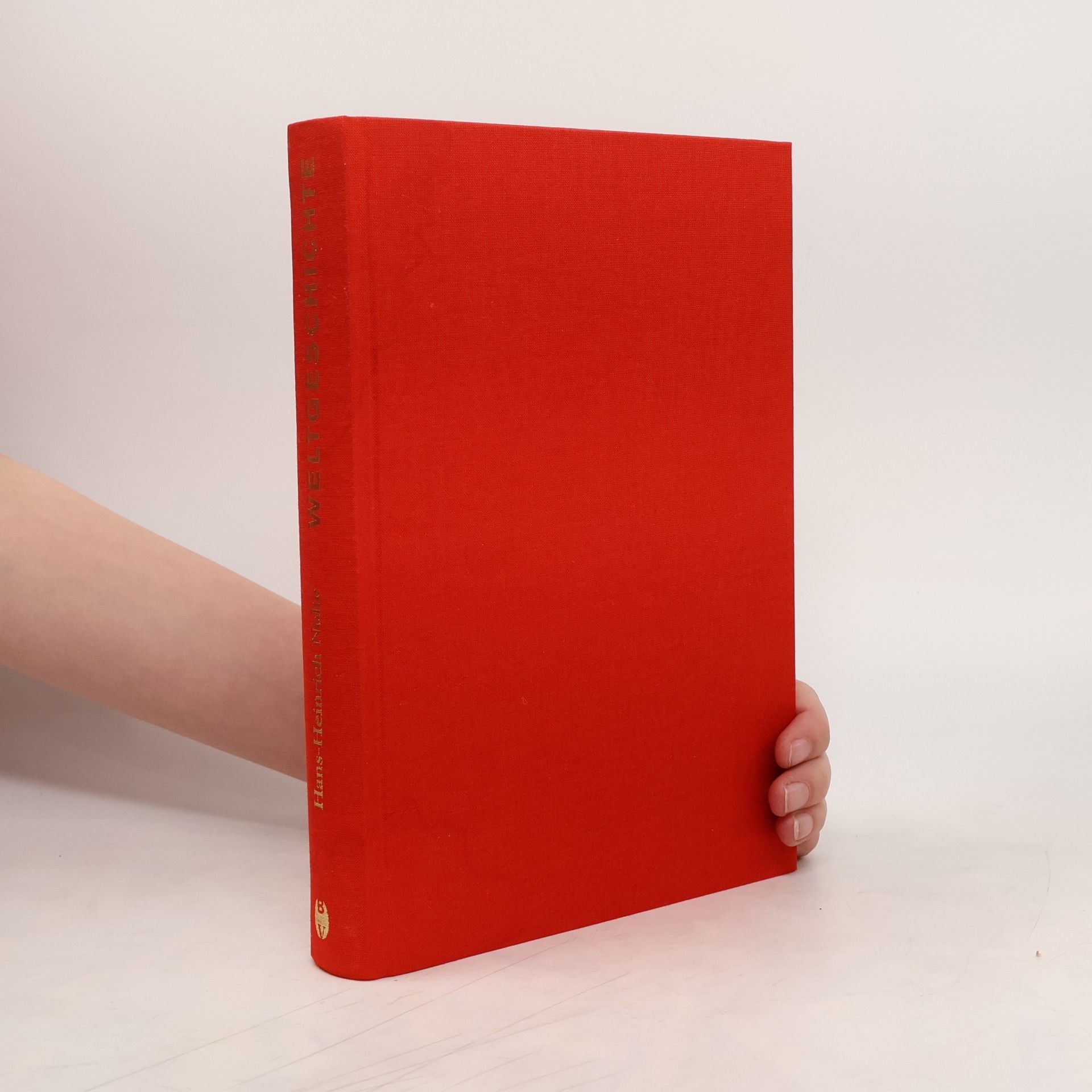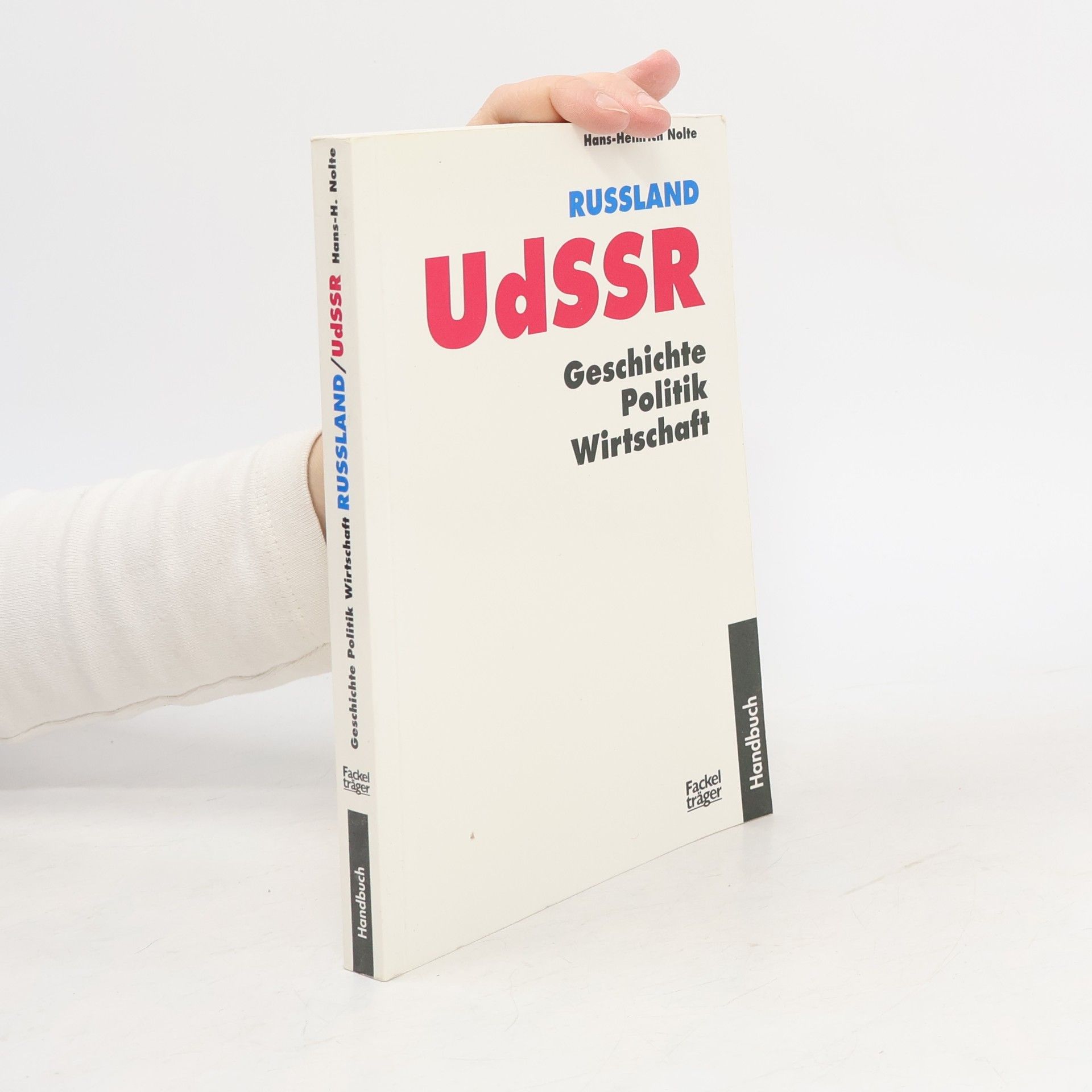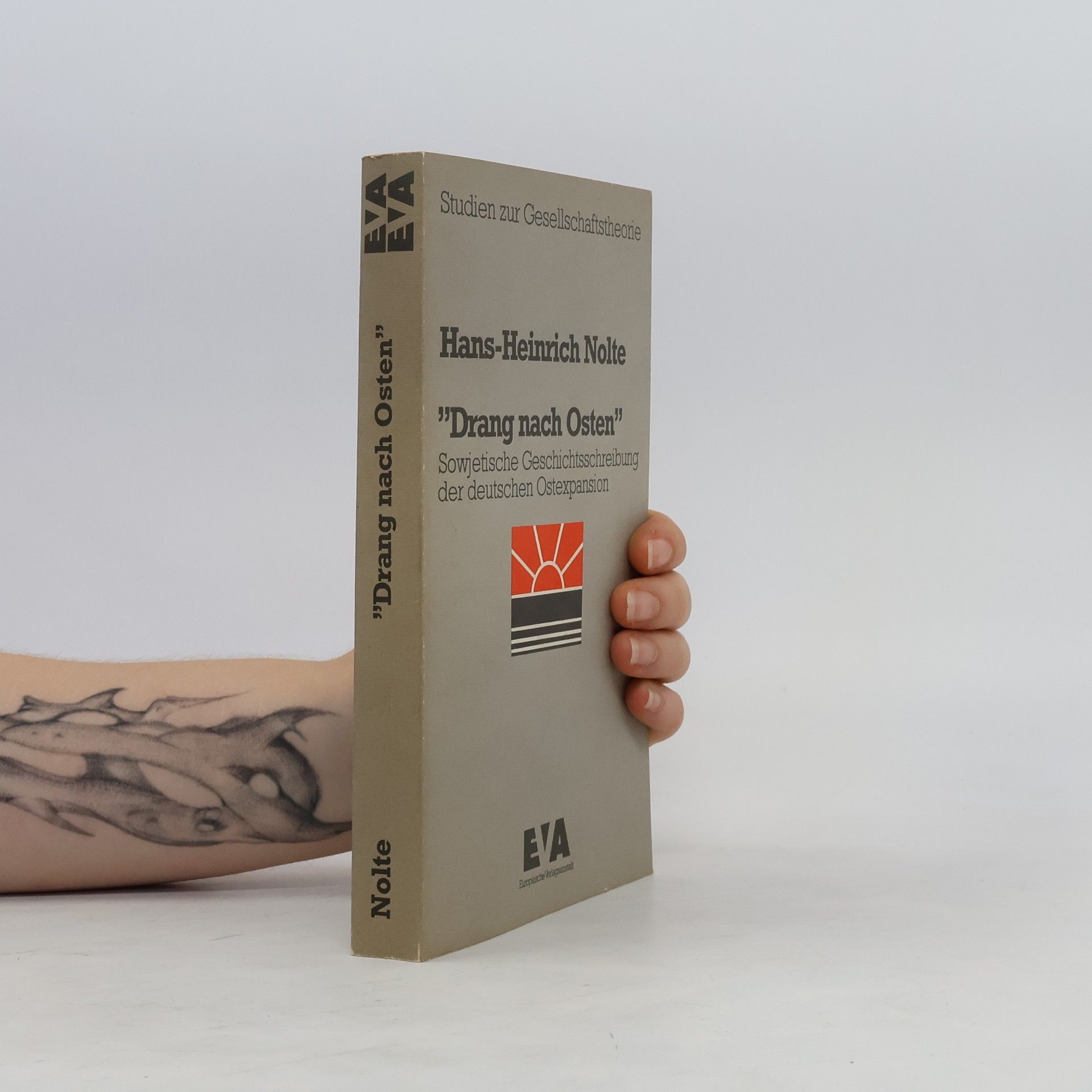Hans-Heinrich Nolte Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

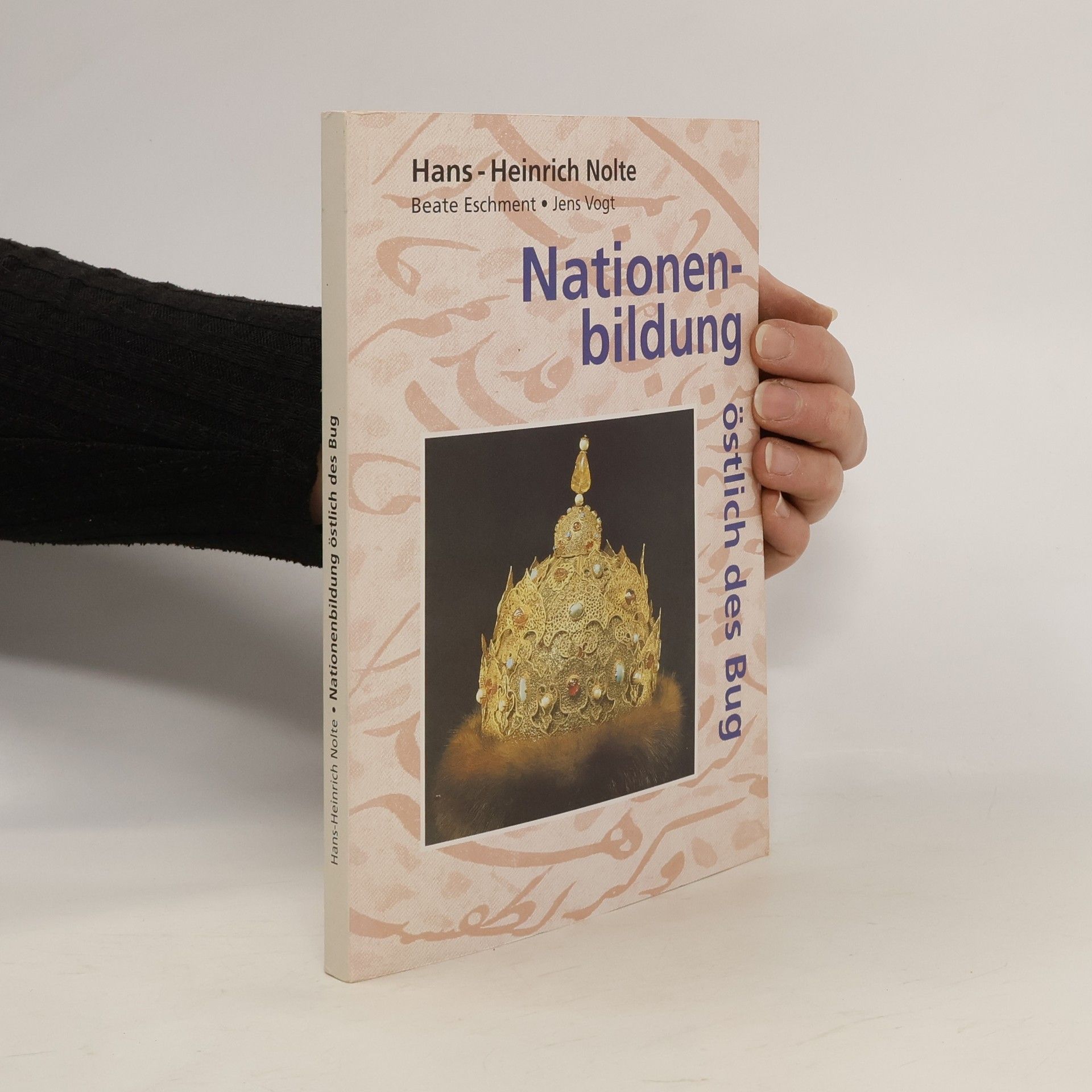
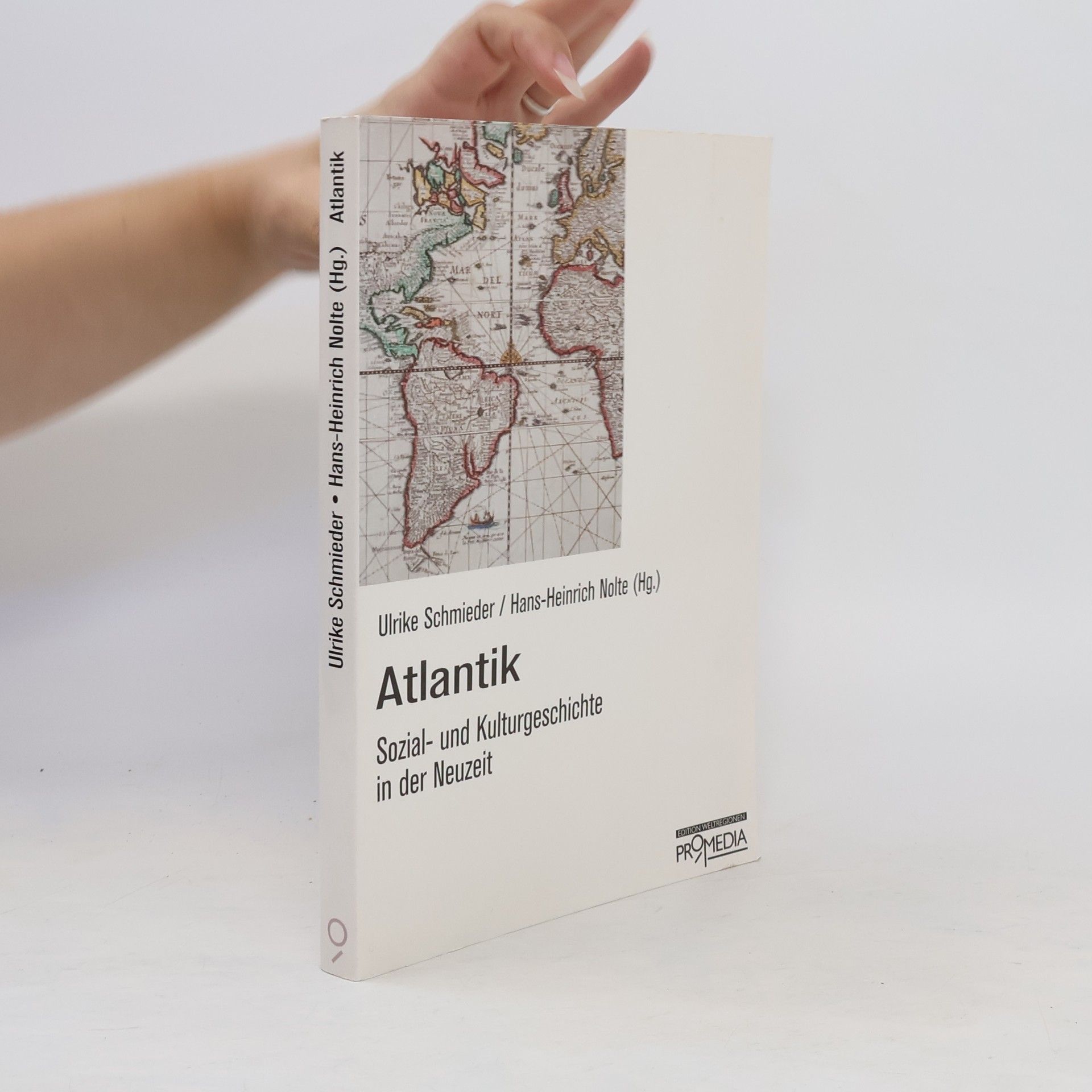



Quellen zur Geschichte Russlands
über 1000 Jahre russische Geschichte in über 400 Quellentexten
Von der Kiewer Rus’ bis zum Ende des Kommunismus, von der Nestor-Chronik bis zu Debatten um die neue Selbstfindung einer Gesellschaft zwischen Putin, Oligarchie und demokratischen Werten – über tausend Jahre russischer Geschichte werden hier lebendig durch mehr als 400 Quellentexte. Die Herausgeber, renommierte Osteuropa-Historiker, haben neben bedeutsamen Erlassen, Verträgen, Resolutionen, Reden, Parteiprogrammen oder Statistiken auch eine Fülle entlegenerer und überraschender Quellen ausgewählt – früheste Reiseberichte, Geheimprotokolle aus endlich geöffneten Archiven oder Beiträge aus aktueller Publizistik – und entrollen ein eindrucksvolles Bild der Geschichte und Geschicke dieses an Widersprüchen reichen Landes.
Die Geschichte Russlands jetzt in 3. Auflage, aktualisiert um das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, und in den übergreifenden Kapiteln vollständig überarbeitet.
Seit dem 16. Jahrhundert umfasst der „Atlantische Raum“ die Kontinente Afrika, die beiden Amerikas und Europa und stellt damit eine Weltregion der besonders ausgedehnten Art dar. Die AutorInnen des vorliegenden Bandes untersuchen diese Weltregion als ein System der Zirkulation von Menschen, Ideen und Gütern. Ihren Schwerpunkt legen sie auf die iberische, lateinamerikanische, afrikanische und karibische Perspektive, sodass die Süd-Süd-Beziehungen einen zentralen Bestandteil der Studien ausmachen, die mehrheitlich sozial- und kulturgeschichtlich ausgerichtet sind.
Weltgeschichte
Imperien, Religionen und Systeme. 15.-19. Jahrhundert
Die Europäer waren nicht klüger oder militaristischer als andere Kulturen und entwickelten nicht mehr Technologien als andere Zivilisationen. Warum war Europa 1815 so dominant und fiel 1914 so tief? Hans-Heinrich Noltes globale Perspektive auf den Aufbruch zur Moderne präsentiert ein neues Bild, das sich von einer eurozentristischen Sichtweise abhebt. Europa besiegte den Rest der Welt, weil es ein System war, in dem Wissen, Fähigkeiten und Institutionen schnell ausgetauscht wurden, während eine unerbittliche Konkurrenz die Staaten zu Intrigen und Aufrüstung trieb. Die militärische Überlegenheit war dabei sekundär. Im Mittelalter wurde dieses System von der Katholischen Kirche zusammengehalten, die moralische Leitlinien bot. Mit der Säkularisierung trat das Konzert der Mächte an die Stelle der Kirche, und aus der Christenheit wurde Europa. Es gelang nicht, eine einheitliche Moral der Staaten zu etablieren, aber neue Expansionsmöglichkeiten lenkten von inneren Konflikten ab. Erst als diese Möglichkeiten erschöpft waren, wandten sich die aufstrebenden Mächte mit ähnlicher Skrupellosigkeit gegen europäische Nachbarn, wie sie es zuvor gegen periphere Länder getan hatten. Das System implodierte. Im 16. Jahrhundert hatten die Eliten asiatischer Großreiche keinen Grund zur Furcht vor den Europäern, da viele Entwicklungen in Eurasien bereits ähnlich verlaufen waren. Doch die Geschichte nahm einen anderen Verlauf.
Kleine Geschichte Rußlands
- 536 Seiten
- 19 Lesestunden
Mit zahlreichen Karten, Schaubildern und Tabellen. Eine Geschichte und Landeskunde Rußlands von der Warägerzeit und der Kiewer Rus bis zur postsowjetischen Ära. Im Zentrum stehen die geographischen Gegebenheiten, die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen des Zarenreiches, der Sowjetunion und des gegenwärtigen Rußland. Mit zahlreichen Dokumenten, Tabellen, Karten und bibliographischen Hinweisen.