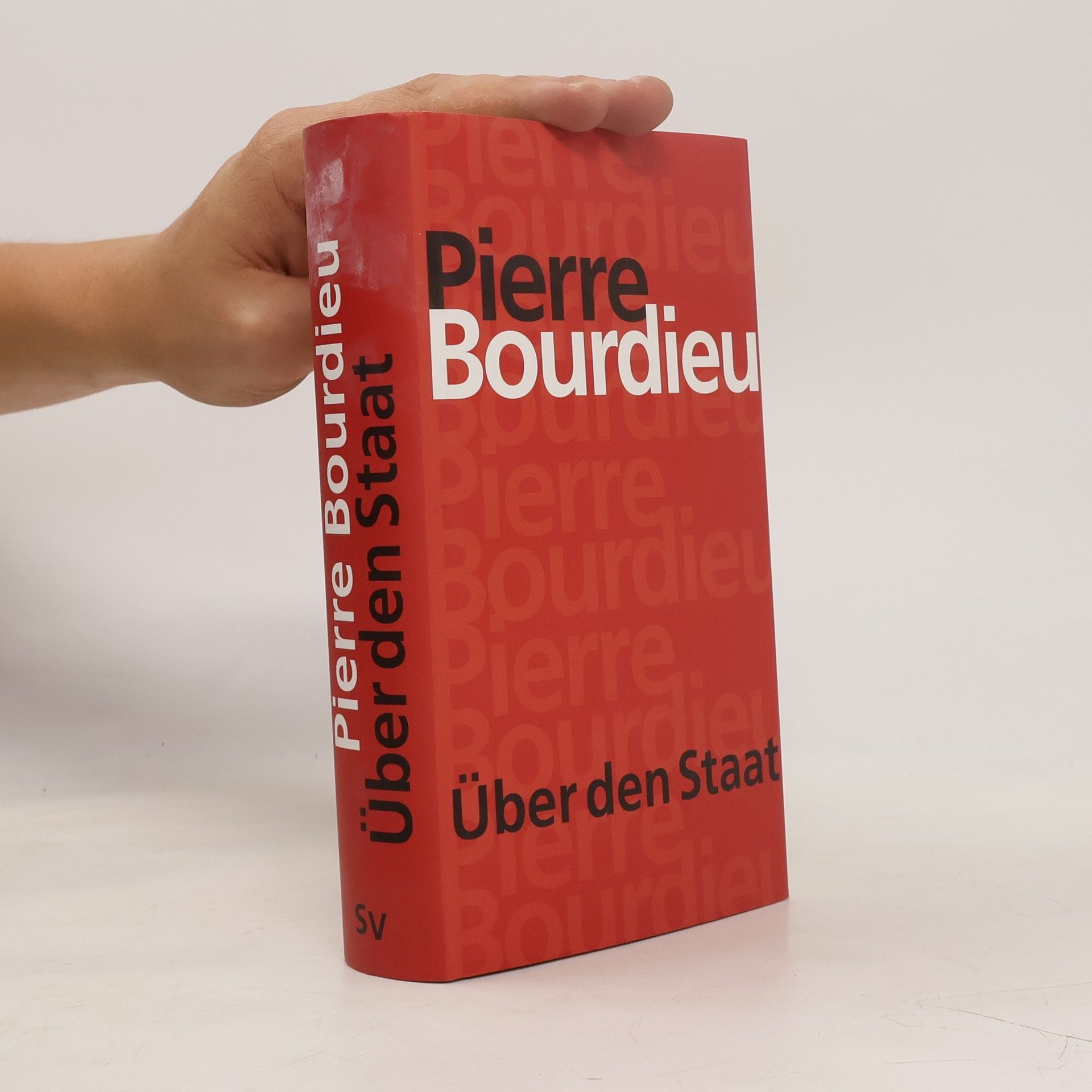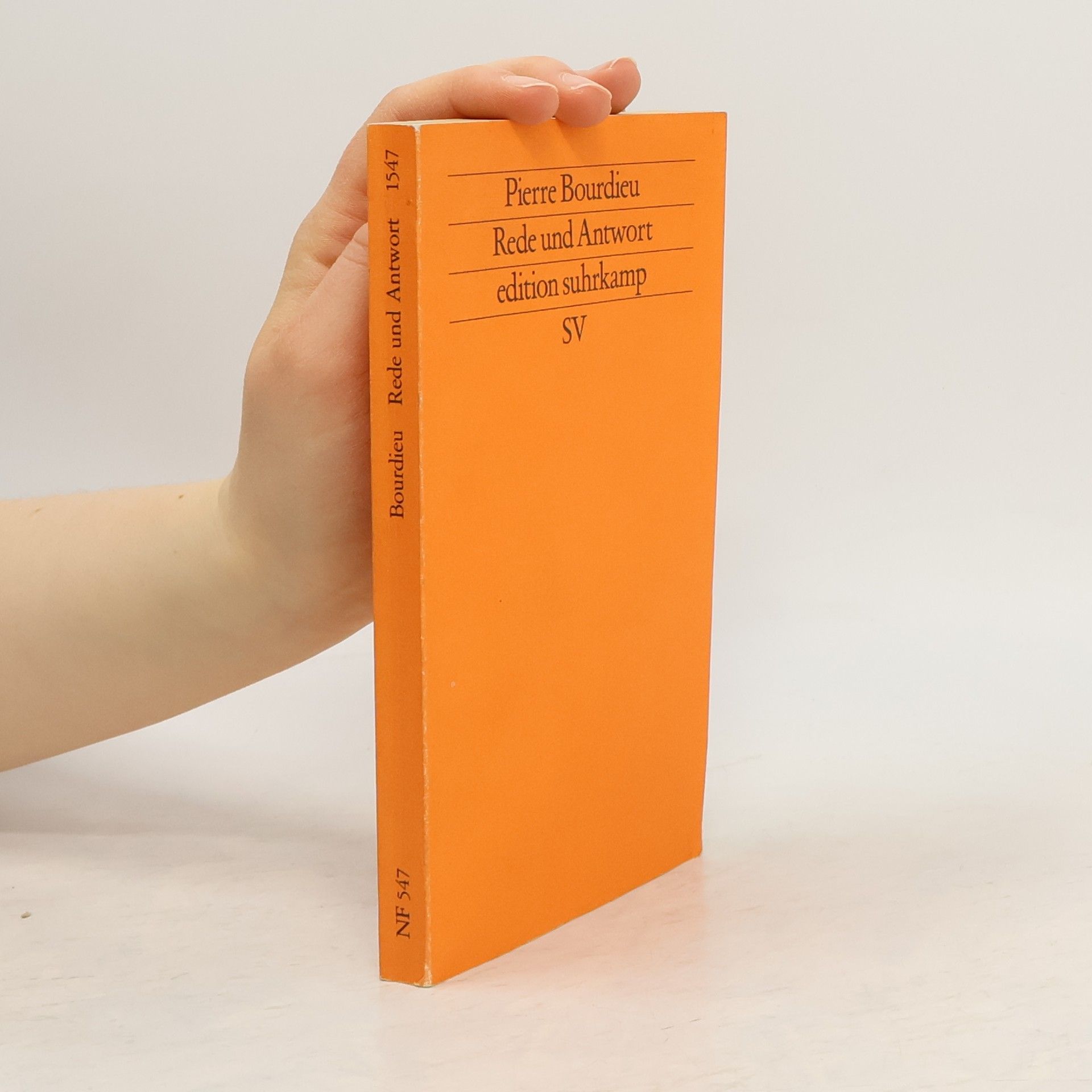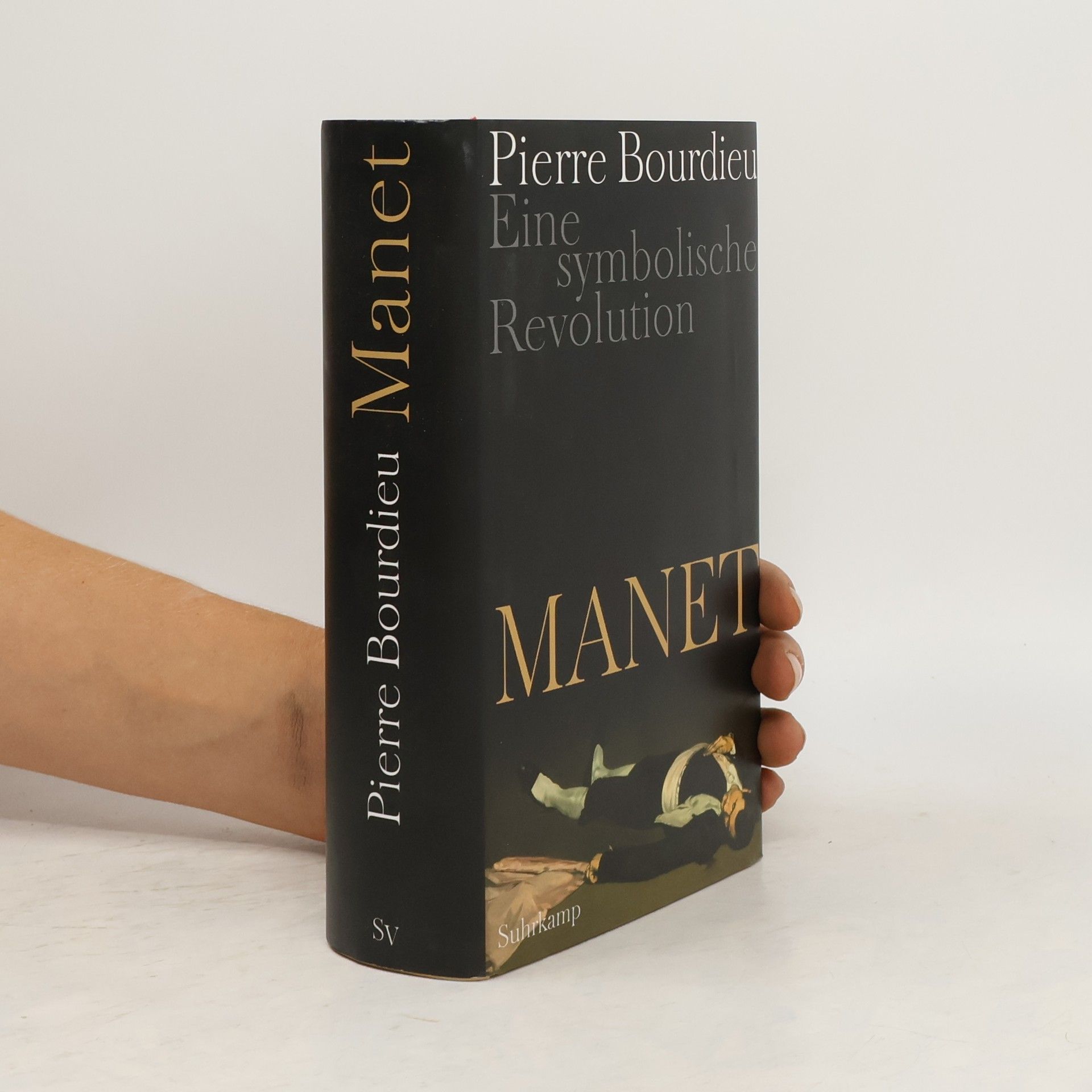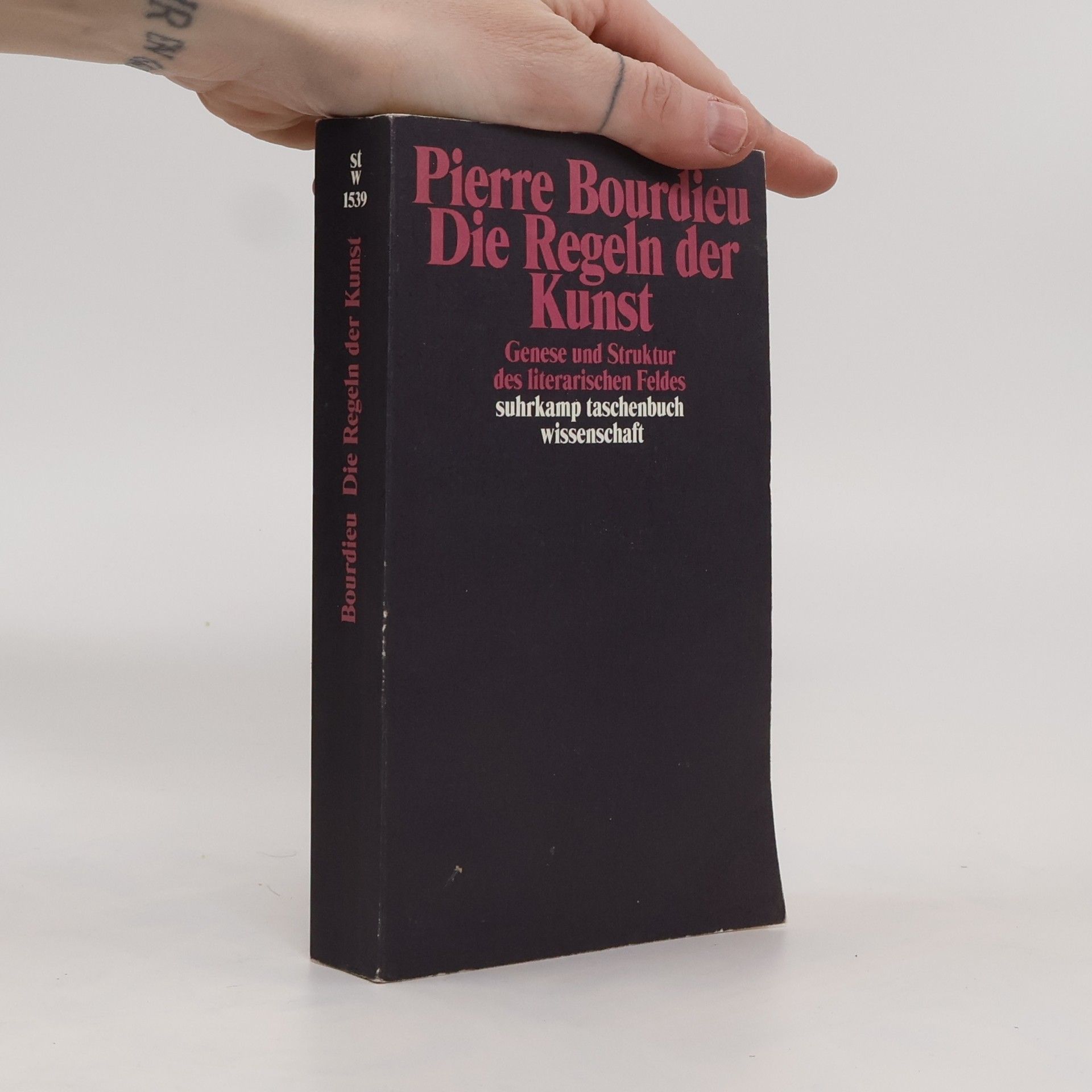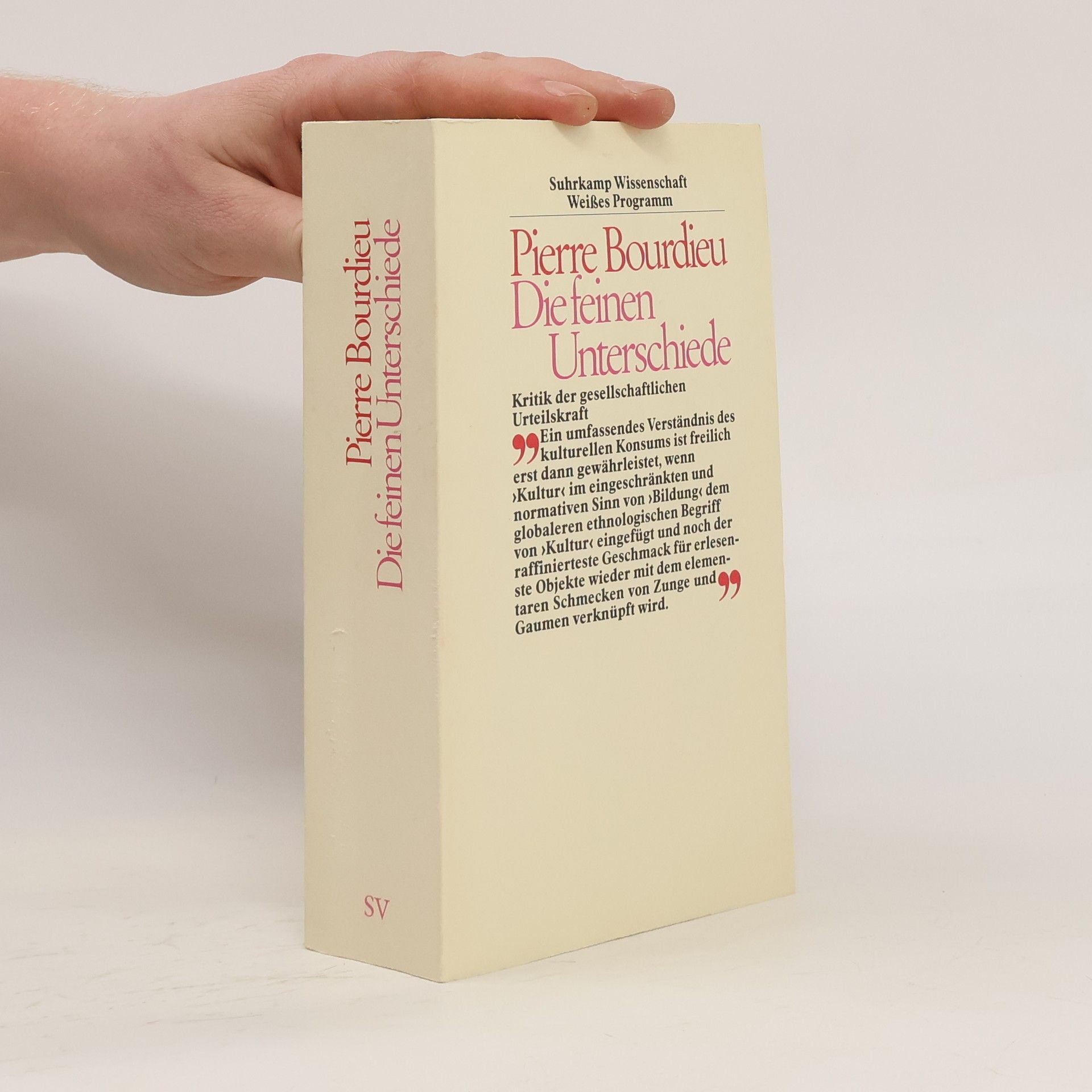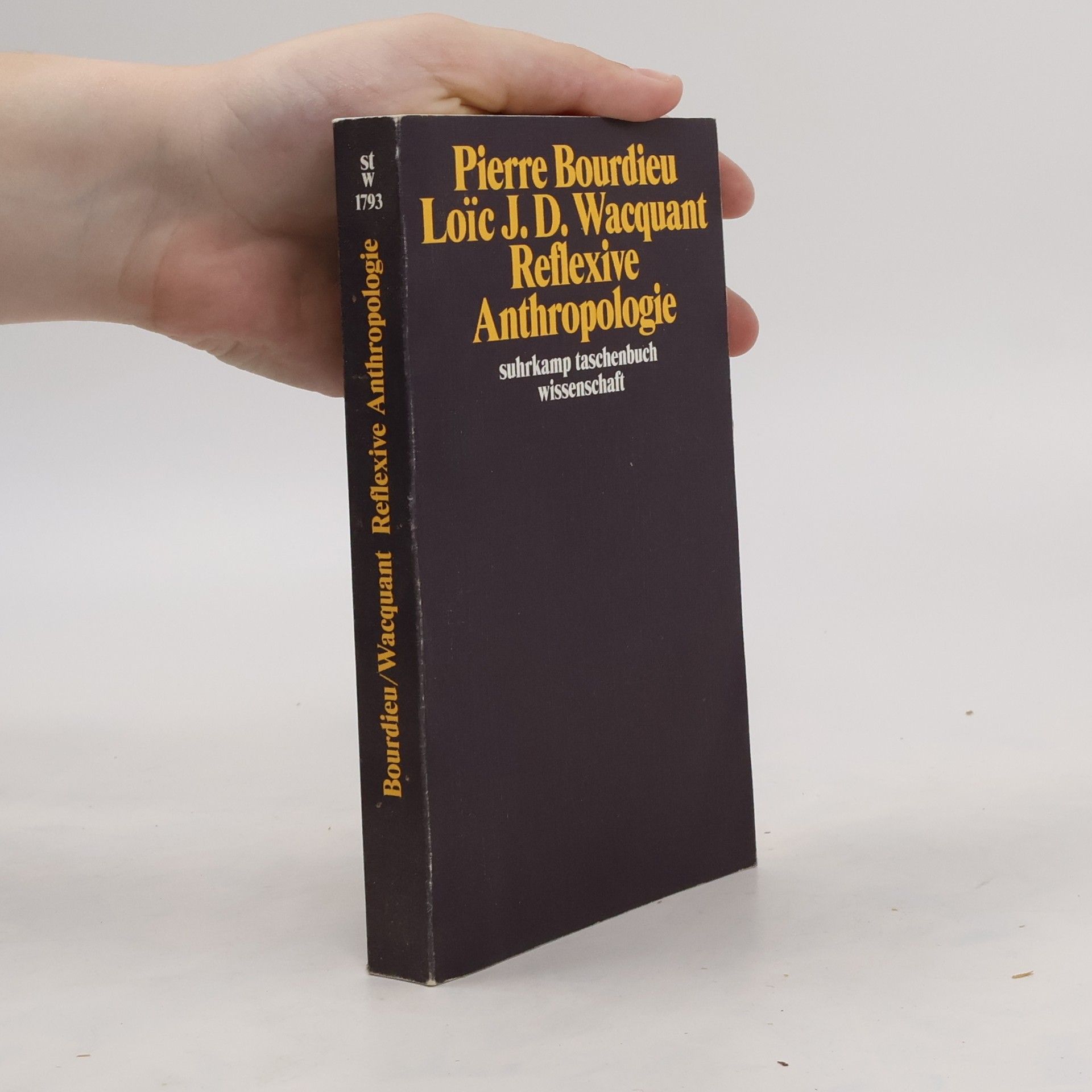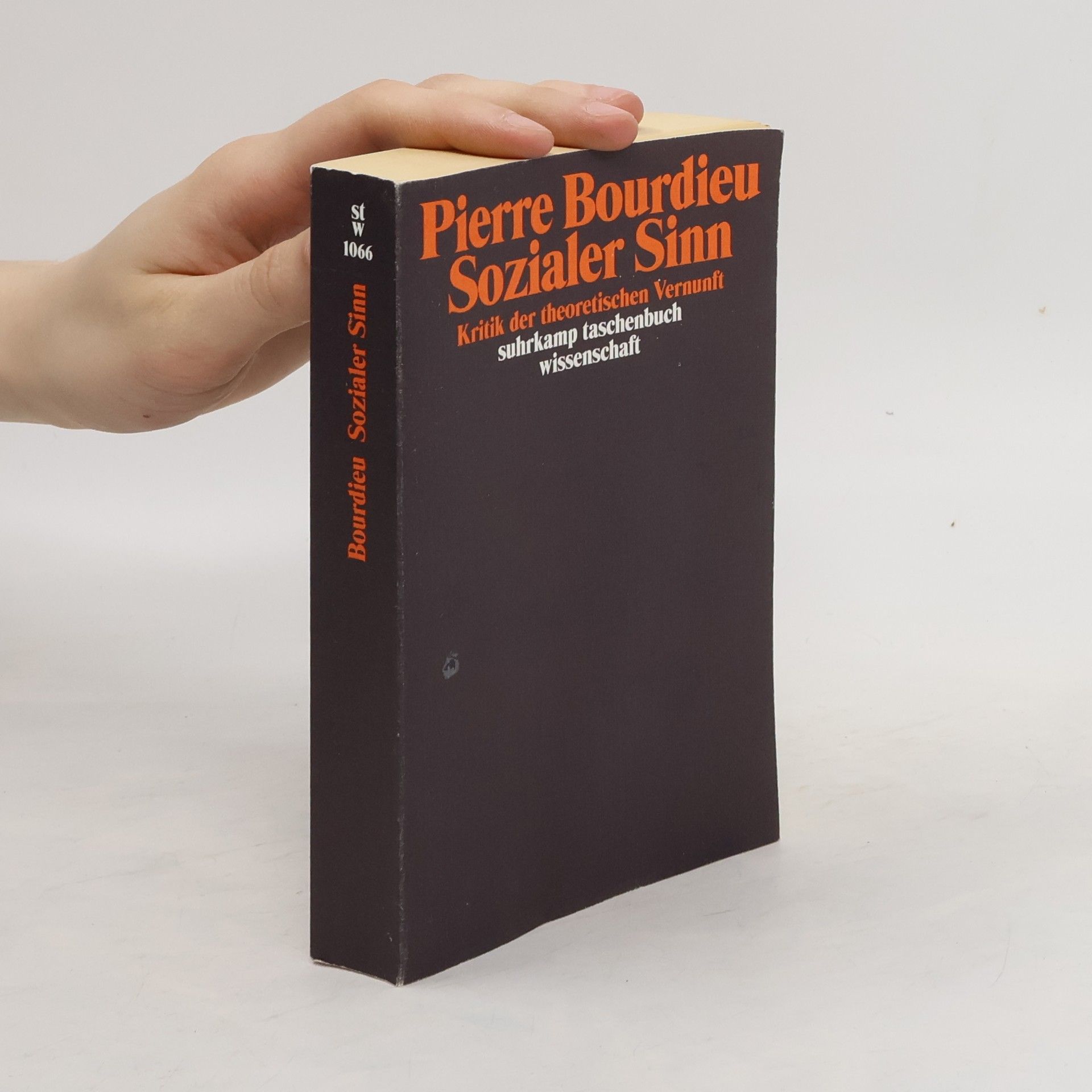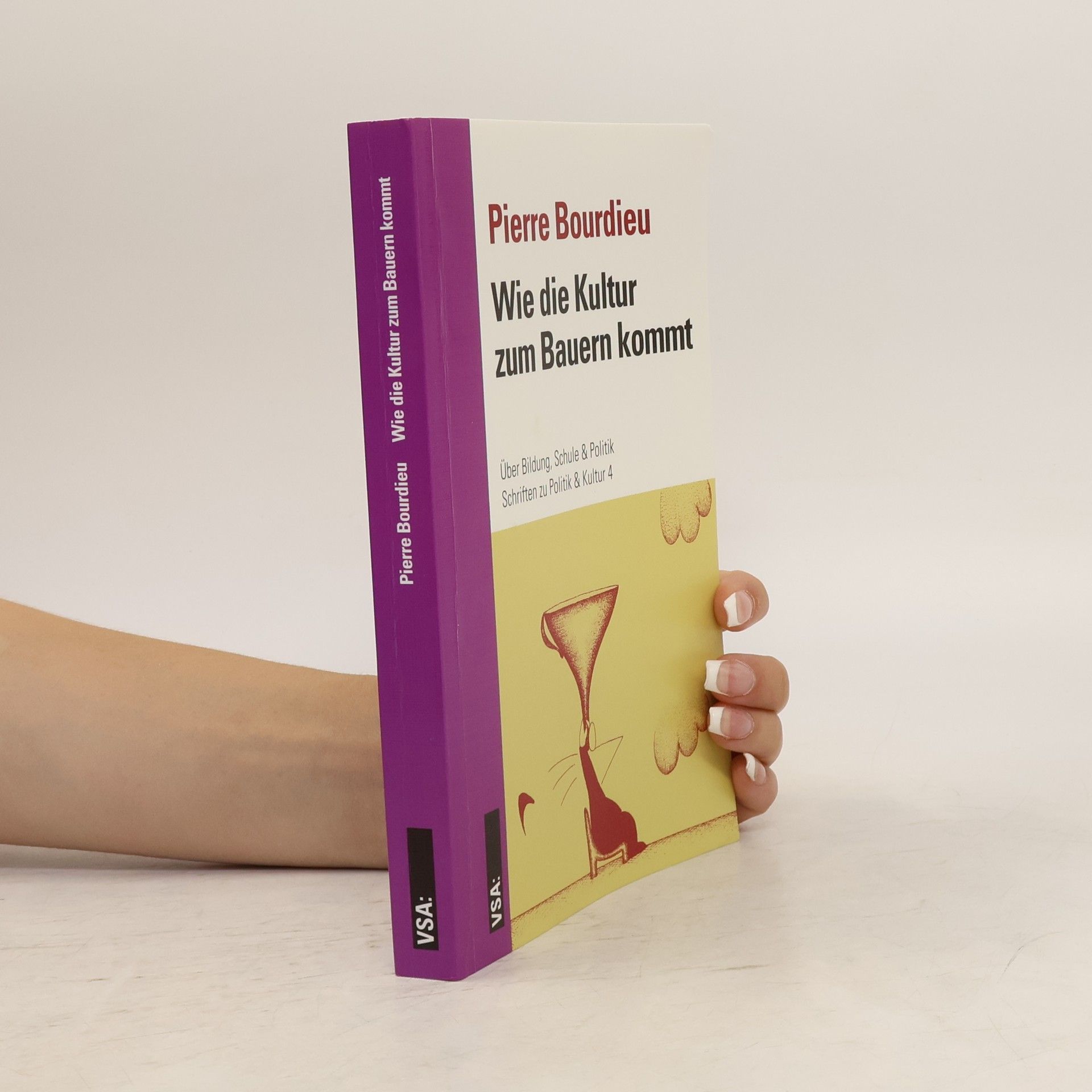Die feinen Unterschiede
- 878 Seiten
- 31 Lesestunden
»Bourdieus Analyse des kulturellen Konsums und des Kunstgeschmacks ist trotz der hohen Anforderungen, die sie an den Leser stellt, nicht bloß für Sozialwissenschaftler, Kunstschaffende und Philosophen von Interesse, sondern für alle, die geneigt sind, ihre eigenen, meist als selbstverständlich aufgefaßten kulturellen Vorlieben und Praktiken zu prüfen. Auch wenn in unserem Land die Kultur einen weitaus geringeren Stellenwert hat als in Frankreich und die westdeutschen Klassenunterschiede weniger augenscheinlich sind als die französischen, sind doch die Strukturen der Distinktion überraschend ähnlich. Der Reiz und auch das Verdienst des Buches liegen darin, daß Bourdieu immer im Kontakt zur konkreten Alltagswirklichkeit bleibt. Dafür sorgen schon die zwischen die schwierigen theoretischen Ausführungen und die Masse des empirischen Materials häufig eingeschobenen Fallbeispiele. Sie laden den Leser zur Identifikation ein, so daß er nicht bloß außenstehender Beobachter bleibt, sondern sich selbst als Gegenstand der Analyse entdeckt. Dadurch wird die Lektüre der Feinen Unterschiede für alle, die sich darauf einlassen wollen, zu einem spannenden Selbsterfahrungsprozeß.« Joachim Weiner