Die Frage nach dem Wesen des Menschseins wird im Kontext der gegenwärtigen Krisen beleuchtet, wobei der Begriff der Person zentral ist. Die Autoren Emmanuel Mounier und Mohamed Aziz Lahbabi, Vertreter des Personalismus, untersuchen, was es bedeutet, eine Person zu sein, und betonen, dass dies über bloße Definitionen hinausgeht. Sie nutzen ihre jeweiligen religiösen Perspektiven, um das Person-Sein zu erforschen und zeigen auf, wie dieser Begriff interreligiöse Begegnungen fördern kann. Das Buch bietet somit tiefgehende Einsichten in die philosophischen und spirituellen Dimensionen der Personalität.
Markus Kneer Bücher
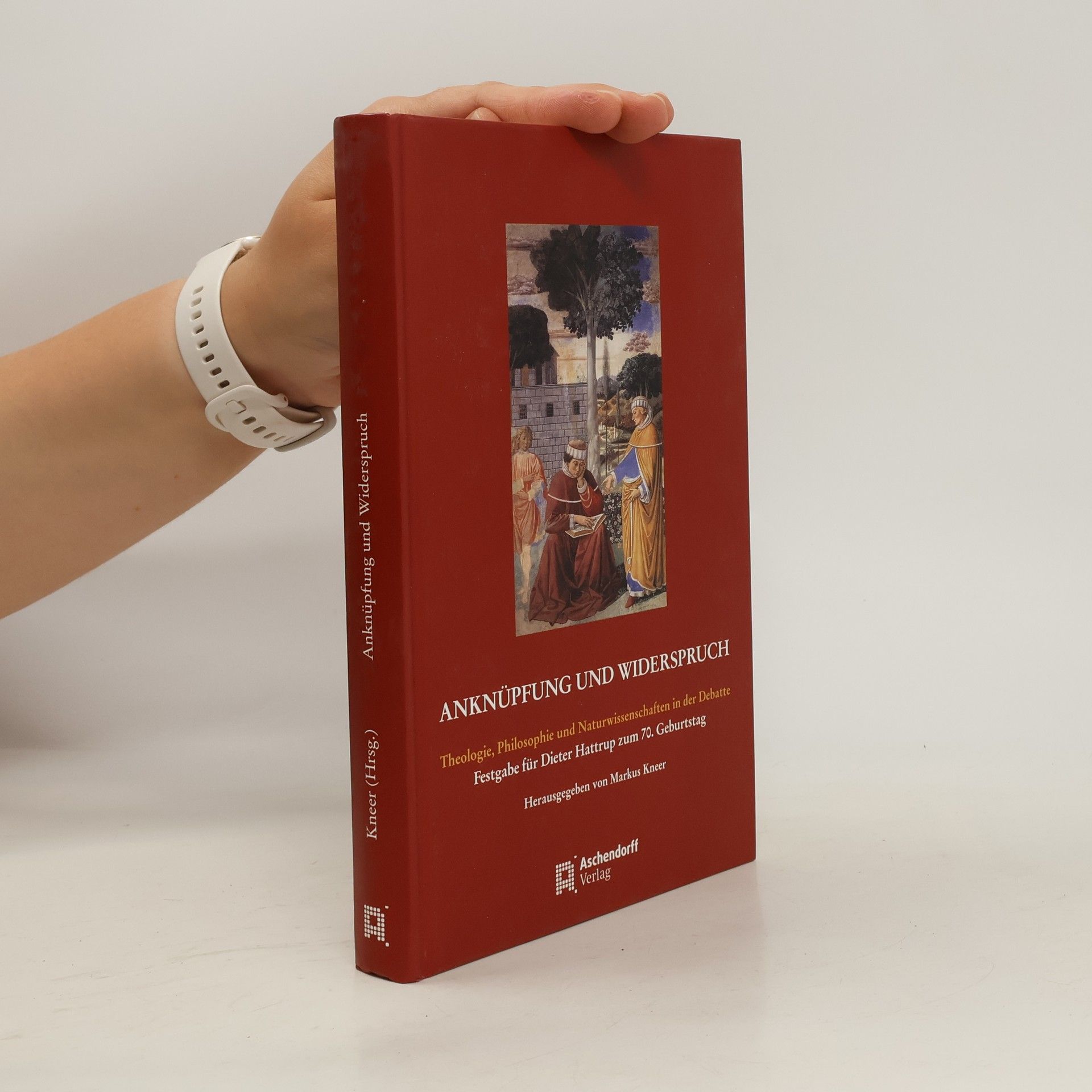

Über 27 Jahre hat Dieter Hattrup (geb. 1948) an der Theologischen Fakultät Paderborn das Fach Dogmatik und Dogmengeschichte vertreten. Diese lange Zeit der theologischen Lehre war gekennzeichnet durch eine intensive Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Weltbildern. Dafür war und ist der Physiker und promovierte Mathematiker in besonderer Weise qualifiziert. Darüber hinaus hat er im theologischen und philosophischen Feld nie den Disput gescheut. Diese Haltung hat Freunde, Kollegen und Schüler inspiriert, ebenfalls in kritischem theologischen, philosophischen oder naturwissenschaftlichen Widerspruch an ihre jeweiligen Forschungsfelder anzuknüpfen – als Festgabe für ihren Wegbegleiter Dieter Hattrup. In den Artikeln kommen die großen theologischen, philosophischen und naturwissenschaftlichen Autoren zur Sprache, mit denen sich der Geehrte auseinandergesetzt hat: Augustinus, Bonaventura, Thomas von Aquin, Galileo Galilei, Charles Darwin, Niels Bohr, Albert Einstein, Carl-Friedrich von Weizsäcker, Stephen Hawking, Fénélon, Albert Schweitzer, Romano Guardini, Karl Rahner, Emmanuel Levinas u. v. m. Die Orte der Reflexion reichen von Münster über Paderborn bis nach Jerusalem. Die Forschungsfelder sind phänomenologischer, theologischer, historischer, anthropologischer, naturphilosophischer und physikalischer Provenienz – ein Fächer der großen intellektuellen Auseinandersetzungen unserer Zeit.