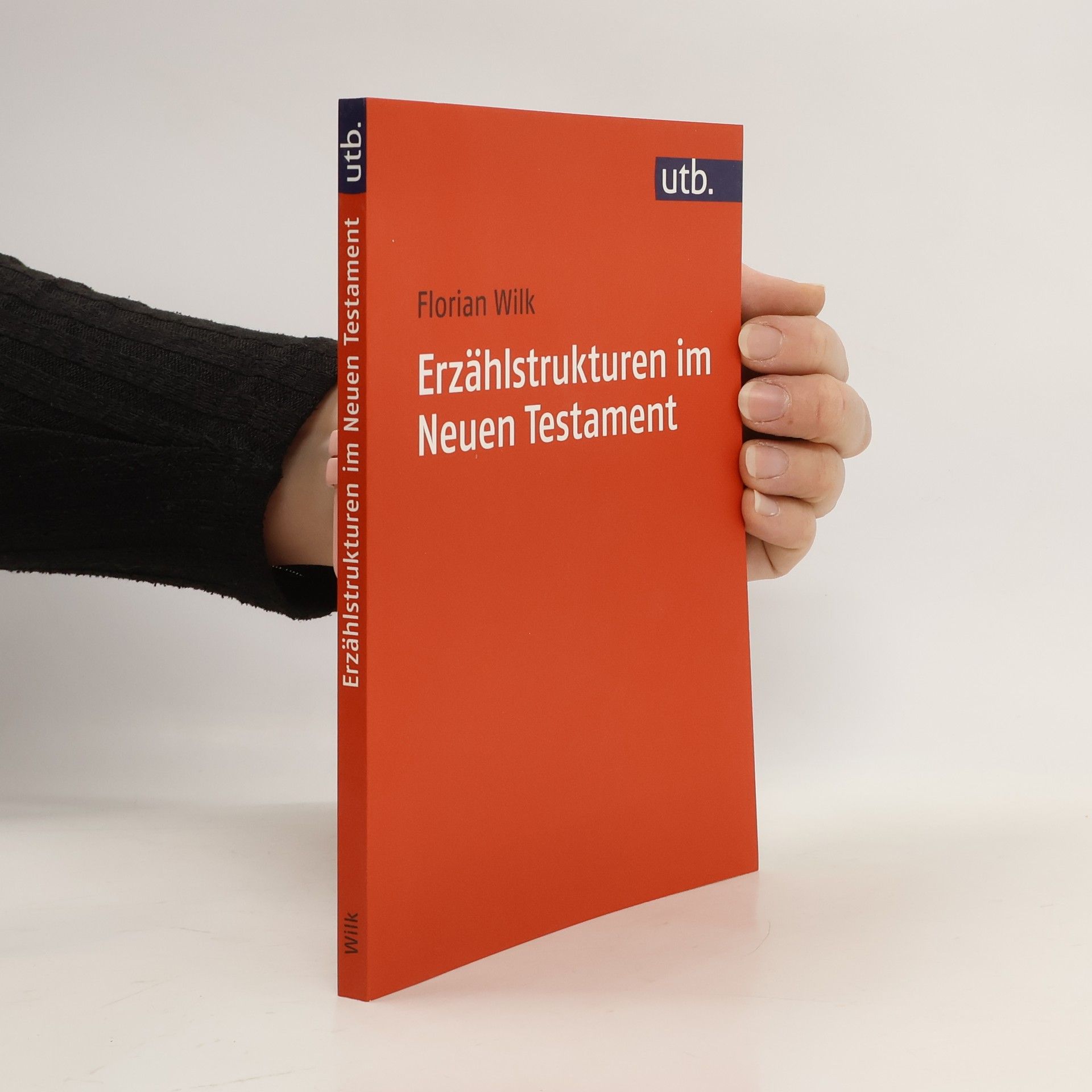Paulinische Schriftrezeption
Grundlagen – Ausprägungen – Wirkungen – Wertungen
Die paulinische Rezeption der Heiligen Schrift stellt die Forschung bis heute vor ein Grundproblem: Wie lassen sich ihre unterschiedlichen Ausprägungen in den Texten des Paulus und seiner Schüler erklären? Um diese Frage einer Antwort zuzuführen, vereint der vorliegende Band Studien zu den traditionsgeschichtlichen und biographischen Grundlagen des paulinischen Schriftgebrauchs, zu seinen vielfältigen brieflichen Ausprägungen und zu seinen Wirkungen in späteren Schriften des Neuen Testaments. Den analytischen Rahmen bilden Beiträge zur Methodik der paulinischen Schriftrezeption sowie zur Reflexion ihrer hermeneutischen Implikationen. Mit Beiträgen von Stefan Alkier, Lukas Bormann, Jan Dochhorn, Jörg Frey, Richard B. Hays, Bart J. Koet, Markus Lang, David Lincicum, Markus Öhler, Stanley E. Porter, Mark A. Seifried, J. Ross Wagner und Florian Wilk.