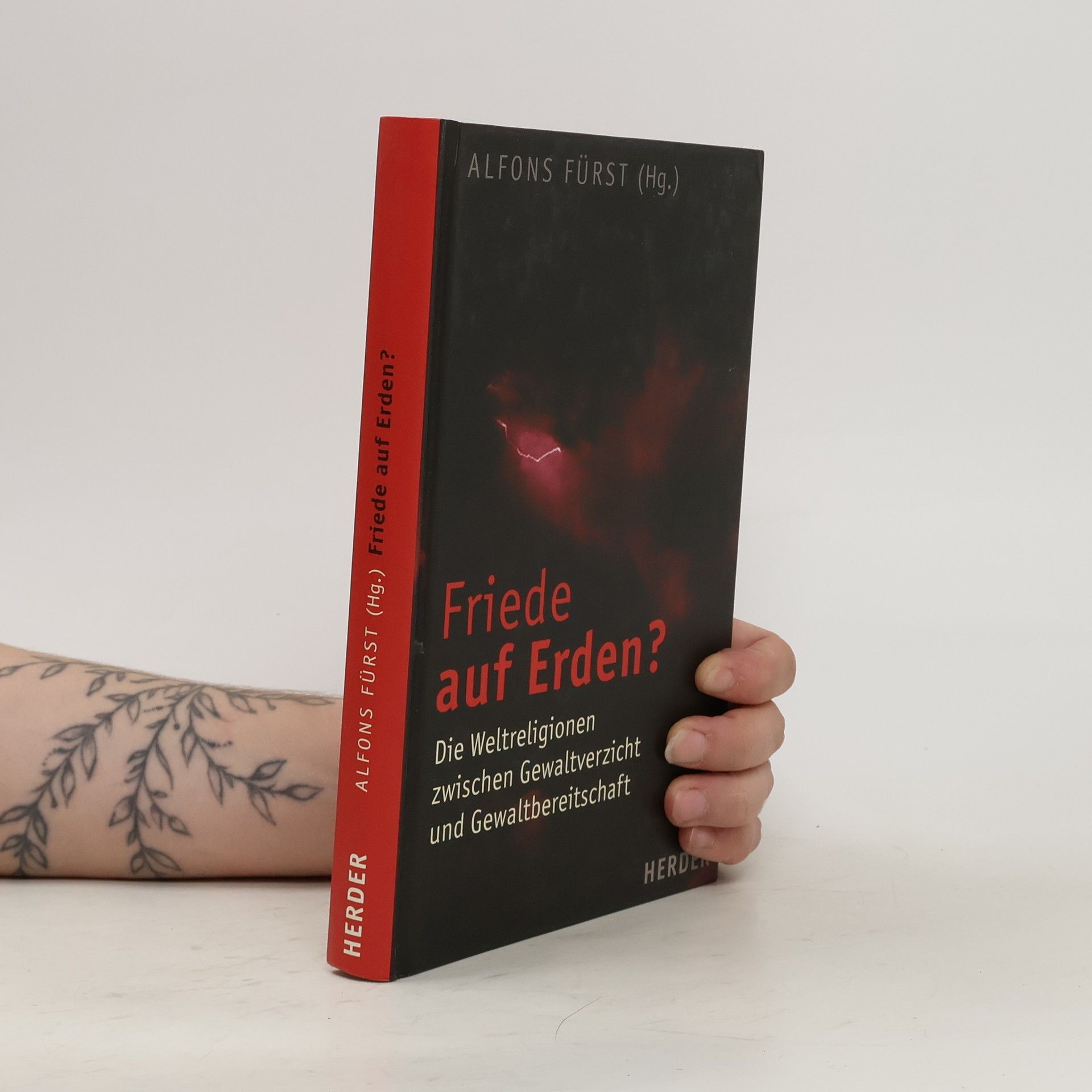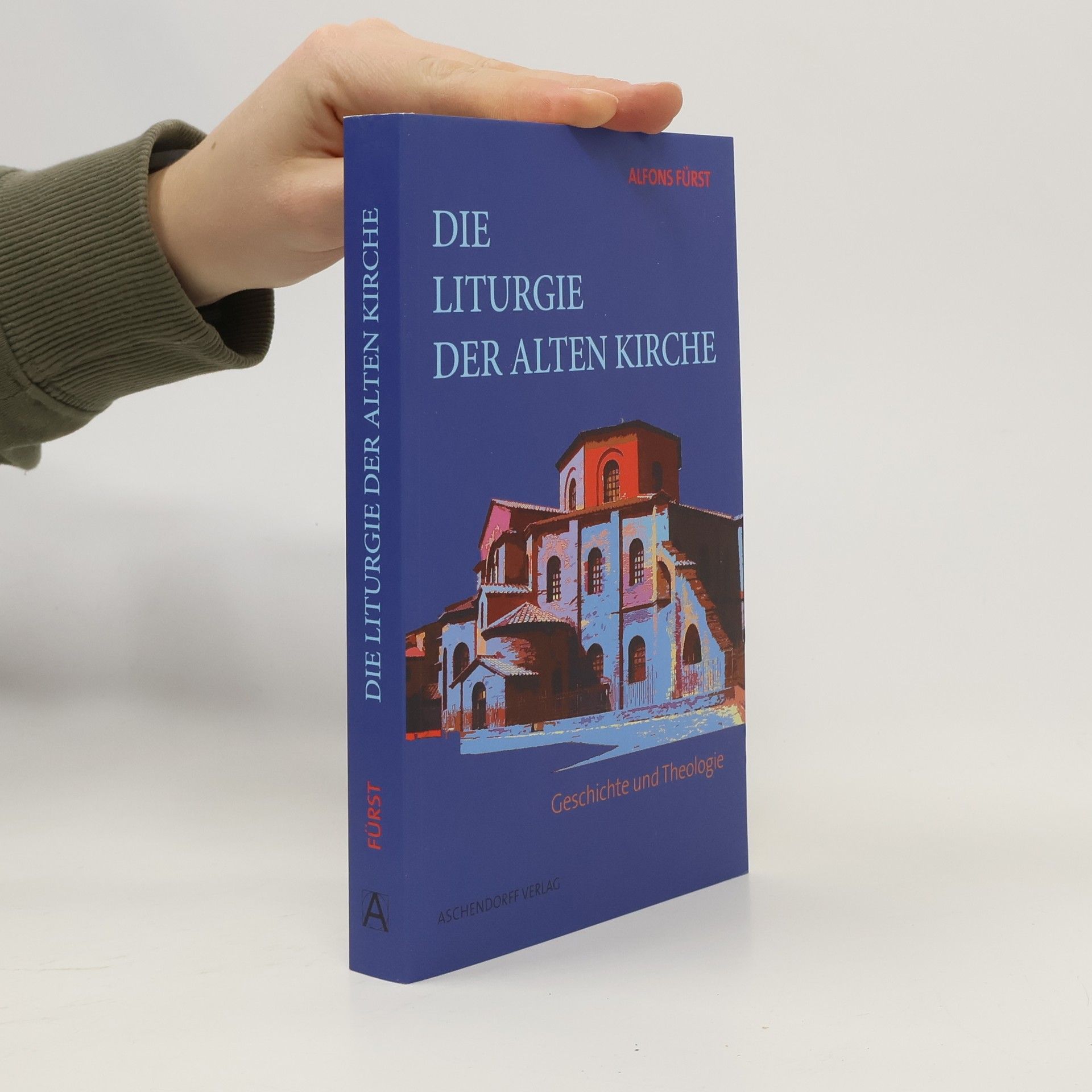Provokateure, Tabubrüche und Denkabenteuer
Grenzüberschreitungen im frühen und spätantiken Christentum. Gedenkschrift für Thomas Karmann
- 348 Seiten
- 13 Lesestunden
Es gilt mittlerweile als akademische Binsenweisheit, dass Grenzziehungen, die das Eigene vom Anderen abgrenzen, einen zentralen Faktor religiöser Identitätskonstruktionen bilden. Dennoch wird die Bedeutung von Grenzüberschreitungen selten reflektiert, obwohl viele neuere Publikationen zum frühen und spätantiken Christentum den Fokus auf Transgressivität legen. Dieser Sammelband verbindet die Diskurse zu religiöser Identität und Transgressivität und untersucht anhand zahlreicher Beispiele die Rolle von Grenzüberschreitungen in den ersten Jahrhunderten für die religiöse Identitätsbildung. Die Frage wird aufgeworfen, ob Grenzüberschreitungen für religiöse Identitäten ebenso wichtig sind wie Grenzziehungen. Bibliker und Kirchenhistoriker suchen Antworten auf diese Fragestellung und beleuchten, wie Grenzüberschreitungen das Verständnis und die Konstruktion religiöser Identitäten christlicher Gruppierungen und Individuen geprägt haben. Der Band bietet somit eine umfassende Analyse und neue Perspektiven auf die Wechselwirkungen zwischen Identität und Transgressivität in der antiken und spätantiken Religionsgeschichte.