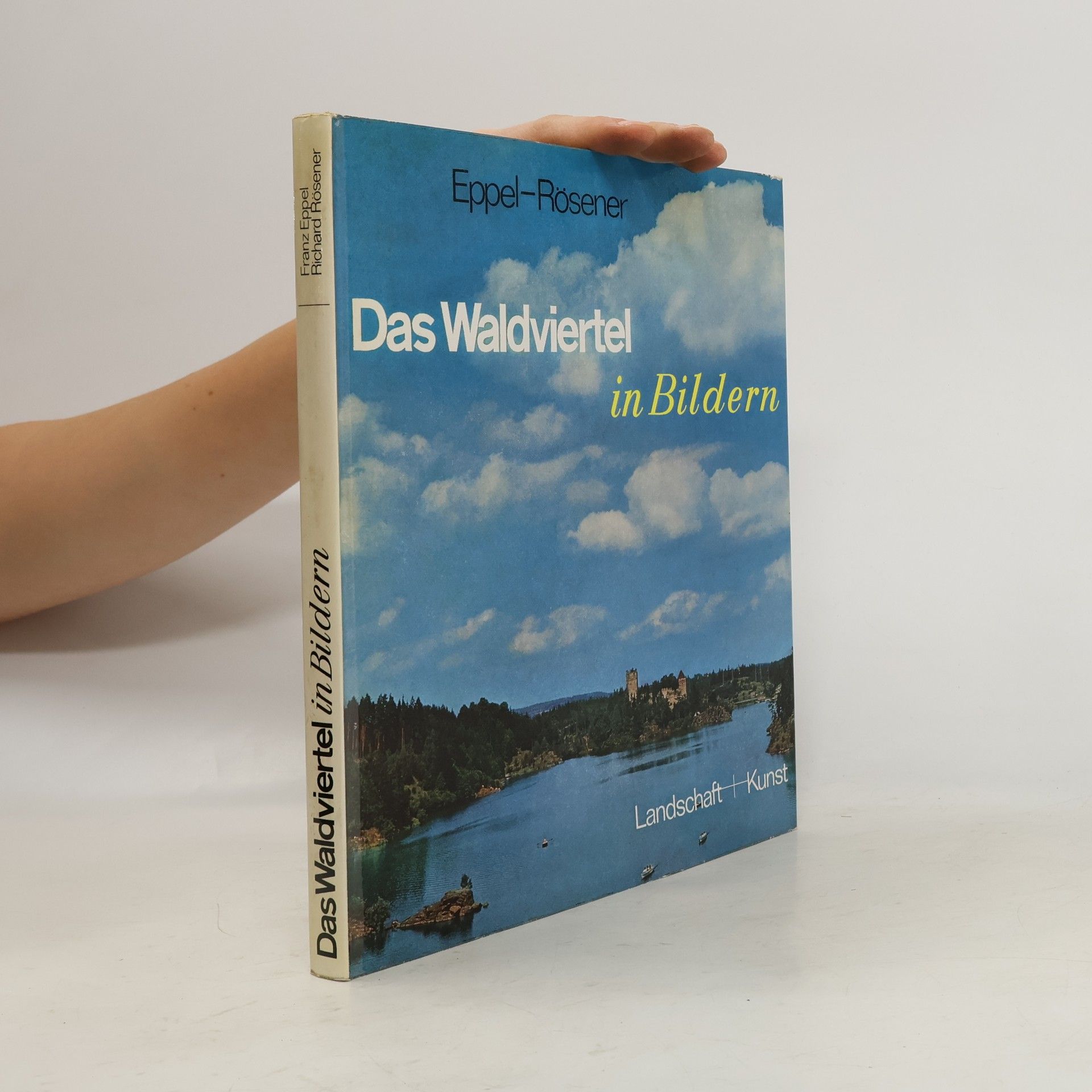Die Geschichte der Jagd. Kultur, Gesellschaft und Jagdwesen im Wandel der Zeit
- 320 Seiten
- 12 Lesestunden
In der »Geschichte der Jagd« beschreibt Werner Rösener die Entwicklung der Jagdkultur von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart. Der opulent bebilderte Band beleuchtet die Jagd als Nahrungsquelle, Statussymbol und Freizeitvergnügen, widerlegt Klischees und betrachtet verschiedene Epochen, einschließlich des Mittelalters und der Renaissance.