Matthias Müller Bücher





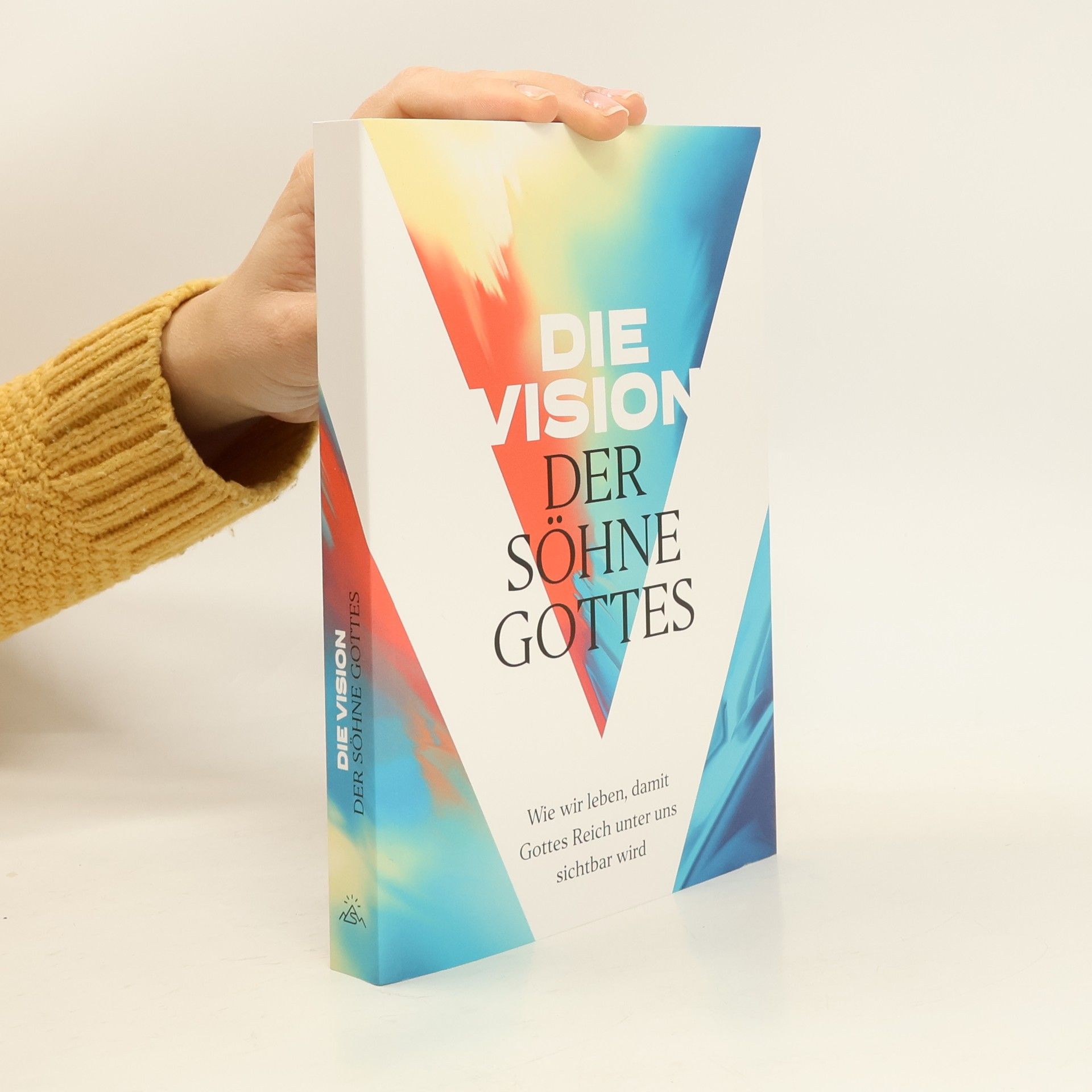
Das Standardwerk zur kommunalen Finanzwirtschaft bietet eine prägnante Darstellung komplexer Regelungen und finanzieller Zusammenhänge. Die Themenvielfalt und die klare Ausrichtung auf kommunale Praxisprobleme zeichnen das Handbuch aus. Der Inhalt umfasst das kommunale Haushaltswesen, die Kosten- und Leistungsrechnung, Vermögen, Kreditwirtschaft, Unternehmen und Beteiligungen, Kassenwesen, Jahresabschluss sowie das Prüfungswesen. Die thematischen Kapitel sind übersichtlich gegliedert, umfassend überarbeitet und an die aktuelle Rechtslage angepasst. Das kompetente Autorenteam setzt die richtigen Schwerpunkte und liefert detaillierte Hinweise zu relevanten praktischen Fragestellungen. Die Kommunal- und Finanzwirtschaft bleibt ein zentrales Gestaltungselement der Kommunalpolitik, insbesondere in Zeiten, in denen Kommunen mit zusätzlichen Aufgaben und unsicheren Finanzierungsmitteln konfrontiert sind. Dies erfordert Kompetenz im Umgang mit finanziellen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen sowie fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das Handbuch ist besonders empfehlenswert für Fachbedienstete im Finanzwesen, Beigeordnete, Bürgermeister sowie alle Verantwortlichen im kommunalen Finanzmanagement.
Geschichtsbilder in Residenzstädten des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit
Präsentationen - Räume - Argumente - Praktiken
- 398 Seiten
- 14 Lesestunden
Die Beiträge dieses Bandes beleuchten die Konzeption, Produktion und Rezeption von Geschichtsbildern in Residenzstädten aus historischer und kunsthistorischer Perspektive. Dabei werden Themen behandelt, die bislang in der Forschung vernachlässigt wurden. Dazu zählen die Ursprungsdarstellungen in der mittelalterlichen Geschichtsschreibung deutscher Bischofsstädte und die Rolle humanistischer Geschichtsvorstellungen für die herrschaftliche Architektur des 15. Jahrhunderts. Auch die Wahrnehmung Budas als Residenzstadt im späten Mittelalter sowie die dynastisch-performative Funktionalisierung von Denkmälern im frühneuzeitlichen Wien werden thematisiert. Zudem wird die monumentale Inszenierung von Geschichte in niederländischen Residenzstädten des 14. bis 16. Jahrhunderts betrachtet, ebenso wie die städtebaulichen Inszenierungsstrategien in Berlin während des Übergangs von der kurfürstlichen zur königlichen Residenz um 1700. Der historische und kunsthistorische Blick auf diese Themen eröffnet neue Einsichten in die Gestaltung und Wahrnehmung von Geschichte in städtischen Kontexten.
Residenzstädte in der Transformation
Konkurrenzen, Residenzverlust und kulturelles Erbe als Herausforderung. Tagungsband der 60. Jahrestagung des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung
- 414 Seiten
- 15 Lesestunden
Der Verlust der ursprünglichen Funktion von Residenzstädten wird in diesem Buch umfassend analysiert. Es werden sowohl die negativen Auswirkungen auf die städtische Struktur als auch die Chancen für eine Neugestaltung und Wiederbelebung dieser Städte betrachtet. Der Autor beleuchtet historische Entwicklungen, gesellschaftliche Veränderungen und innovative Ansätze zur Revitalisierung, die eine Balance zwischen Verlusten und Gewinnen aufzeigen. Zudem werden Beispiele aus verschiedenen Regionen präsentiert, die die Vielfalt der Herausforderungen und Lösungen verdeutlichen.
"So nah am Rand" ist eine Zusammenarbeit von Matthias Müller und den Künstlerinnen Anita Bürgi, Cristina Ginocchio und Gabriela Huldi. Das Buch lädt die Leser ein, durch 19 Räume aus Text und Malerei zu wandern und zu erkunden, was der Rand der Gegenwart bedeutet. Es thematisiert Emotionen, Worte und Formen.
Entdecken - Probieren - Lösen
Fertige Stundenentwürfe für spielerischen Mathematik-Unterricht in der Sek I
Migrationsfachdienste
Sozialarbeiterische und stärkenorientierte Hilfeprozesse gestalten
Die Praxis der Migrationsfachdienste realisiert sich innerhalb von widersprüchlichen politischen und rechtlichen Vorgaben, die sowohl die Nutzerinnen und Nutzer in ihrer Entwicklung behindern als auch die sozialarbeiterische Fachlichkeit blockieren können. In diesem Klima ist es für Fachkräfte im Feld schwer, sich auf den sozialarbeiterischen Kern ihrer Arbeit zu konzentrieren und optimale Hilfeprozesse zu gestalten. Matthias Müller erörtert in diesem Buch einige die Arbeit der Migrationsfachdienste bestimmenden Widersprüchlichkeiten. Darüber hinaus skizziert er kurz und knapp wesentliche Facetten guter Fachlichkeit für die Migrationsfachdienstarbeit. Dafür bettet er die Arbeitsweisen des stärkenorientierten Migrationsfachdienst Case Management, der sozialpädagogischen Begleitung, der Gruppenangebote, der Sozialraumangebote und der interkulturellen Öffnung der Regeldienste in den Fachdiskurs der Sozialen Arbeit ein. Kurze Fallbeispiele und Arbeitsinstrumente geben Anregungen für die praktische Arbeit.
Wandern in Nordhessen
Die schönsten Fotospots entdecken
Seen, die sich wie Fjorde durch die Landschaft schlängeln, UNESCO-prämierte Kulturdenkmäler und echten Urwald: Das alles und noch viel mehr kann man in Nordhessen entdecken. Ob der Edersee mit Nationalpark oder der Bergpark Kassel, Wanderliebhaberinnen und -liebhabern werden hier viele reizvolle Ansichten und Aussichten geboten. Doch auch Orte und Landschaften für ausdrucksstarke Bilder mit faszinierenden Lichtstimmungen, die bisweilen wie Gemälde wirken, gibt es in Nordhessen in Hülle und Fülle. Beides, Wandern und Fotografieren, lässt sich in der Region rund um den Großraum Kassel wunderbar kombinieren. Dafür wurden in „Wandern in Nordhessen. Die schönsten Fotospots entdecken“ ausgewählte Routen zusammengestellt, die den reich bebilderten Wandertipps jeweils die schönsten Motive zum Fotografieren zur Seite stellen. Versehen mit Tipps und Tricks sowie einem ausführlichen Serviceteil inkl. Karten und GPS-Tracks.
Die Buchreihe stellt die Funktion kleiner Textsorten in publizistischen, wissenschaftlichen und administrativen Kontexten in den Mittelpunkt. Sie reagiert damit auf die Aktualität und Schlagkraft kurzer Formen vor dem Hintergrund medialer Mobilitätsschübe, knapper Aufmerksamkeitsressourcen und neuer Kommunikationsökonomien. Die Einzeluntersuchungen sind zudem von der Frage geleitet, welche Wirksamkeit eine Vielfalt von unscheinbaren Genres wie Skizze, Abstract, Notiz, Aphorismus, Protokoll, Exzerpt, Essay, Artikel, Glosse etc. in der Organisation und Vermittlung von Wissen auf diversen Praxisfeldern entfaltet haben - von der Antike bis zur Gegenwart.