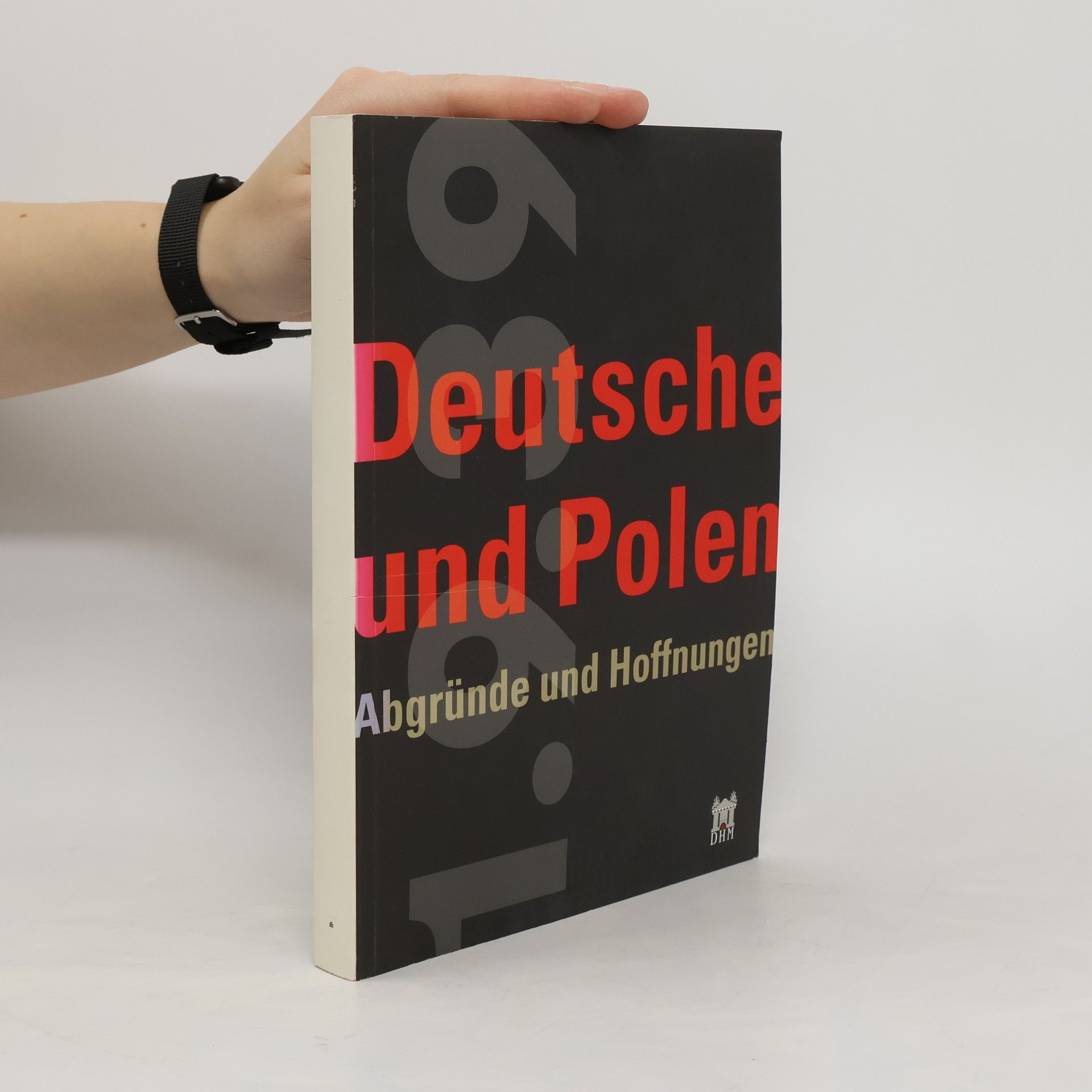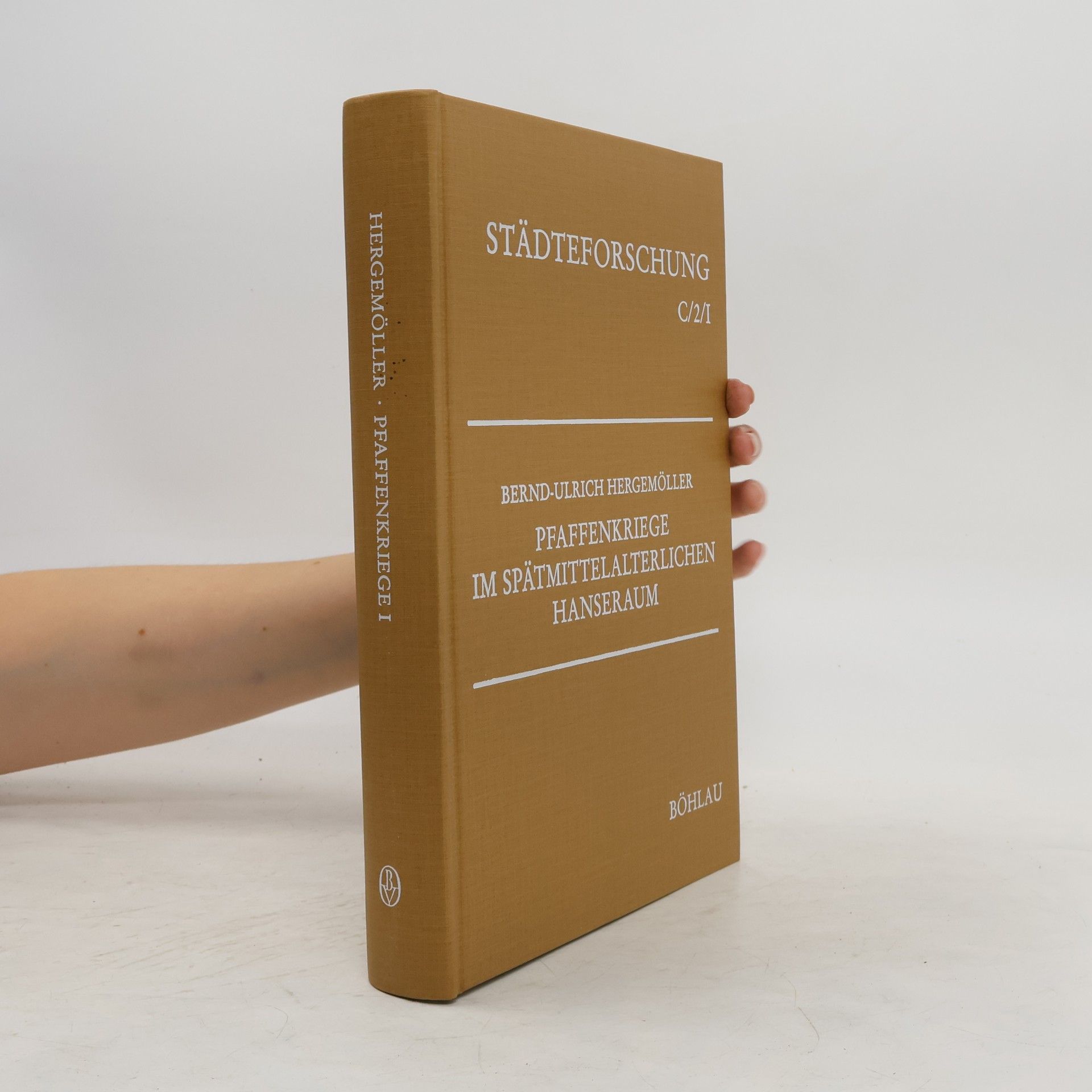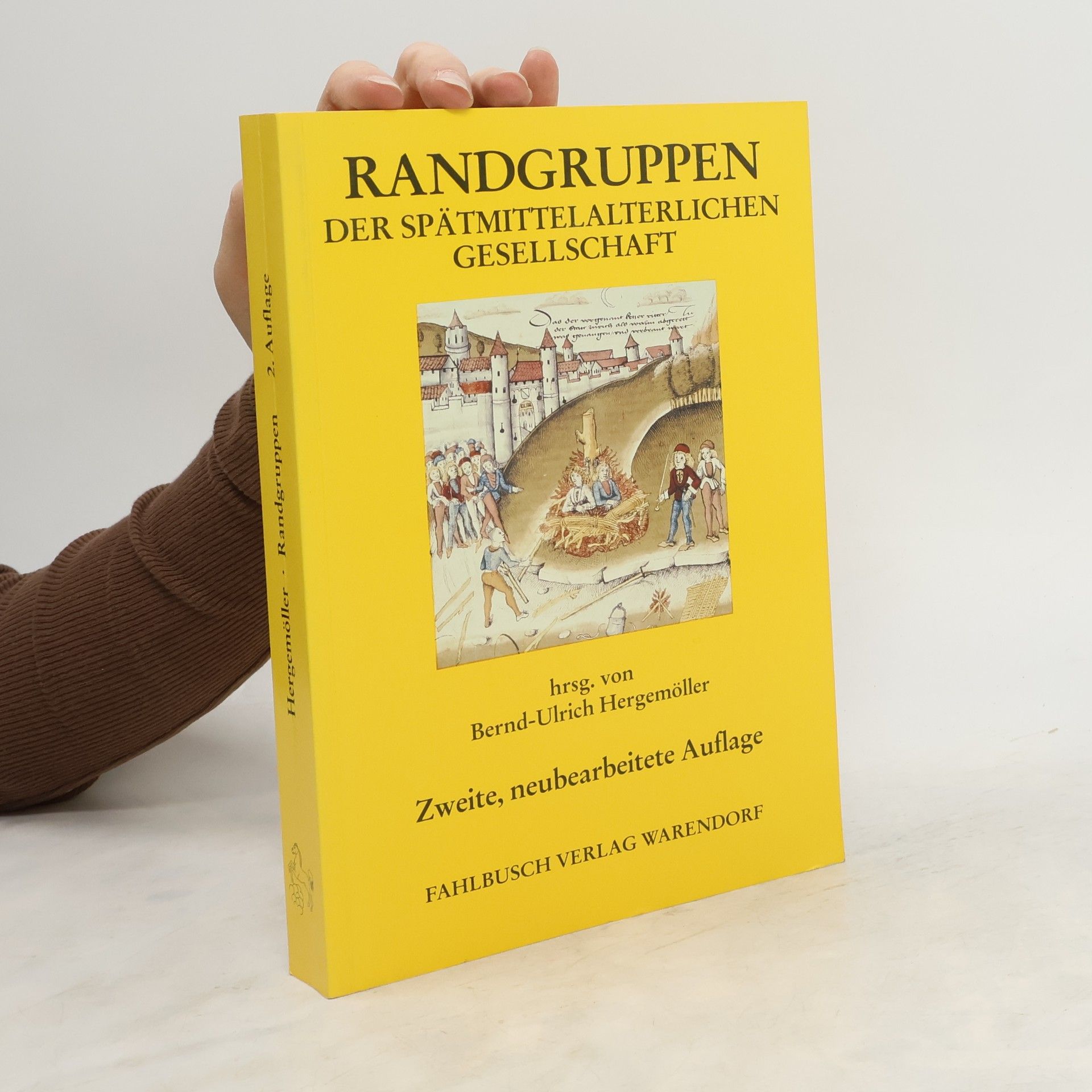Das Wüten der Welt. Die politischen Selbstverständlichkeiten sind gehörig ins Wanken geraten. Die Welt, wie wir sie kannten, ist »aus den Fugen«. Doch mittlerweile zeigen sich die Konturen einer neuen Welt immer klarer. Man muss sie nur sehen wollen. Die Erschütterungen dieser Jahre sind hilfreich und notwendig, um den aufgeklärten, aber auch privilegierten Kreisen dieses Landes die Augen zu öffnen für die Ursachen, die viel zu lange verdrängt worden sind: die Wucht, mit der die weltweiten Krisenherde an unser Leben unmittelbar heranrücken, und die grotesken und obszönen Ungerechtigkeiten, die so sichtbar werden und die sich die Opfer nicht mehr bieten lassen, bei uns und weltweit ... In Zeiten von Brexit, Trump-Amerika, IS-Terror, weltweiter Flüchtlingsströme und neuem Nationalismus wächst das Bedürfnis und die Notwendigkeit politischer Bestandsaufnahmen und Analysen, die über den Tag hinaus reichen. Dieser Arbeit hat sich Bernd Ulrich, Leiter der Politik-Redaktion der Zeit, in den letzten Jahren mit Bravour gewidmet und bei den zahllosen nationalen und internationalen Krisen immer wieder mit kühlem Verstand nach Ursachen und Zusammenhängen gefragt. Darauf basierend entwirft Bernd Ulrich ein präzises Epochenbild, das für die politische Kultur dieses Landes und für ein höchst notwendiges demokratisches Engagement unverzichtbar ist.
Bernd-Ulrich Hergemöller Bücher



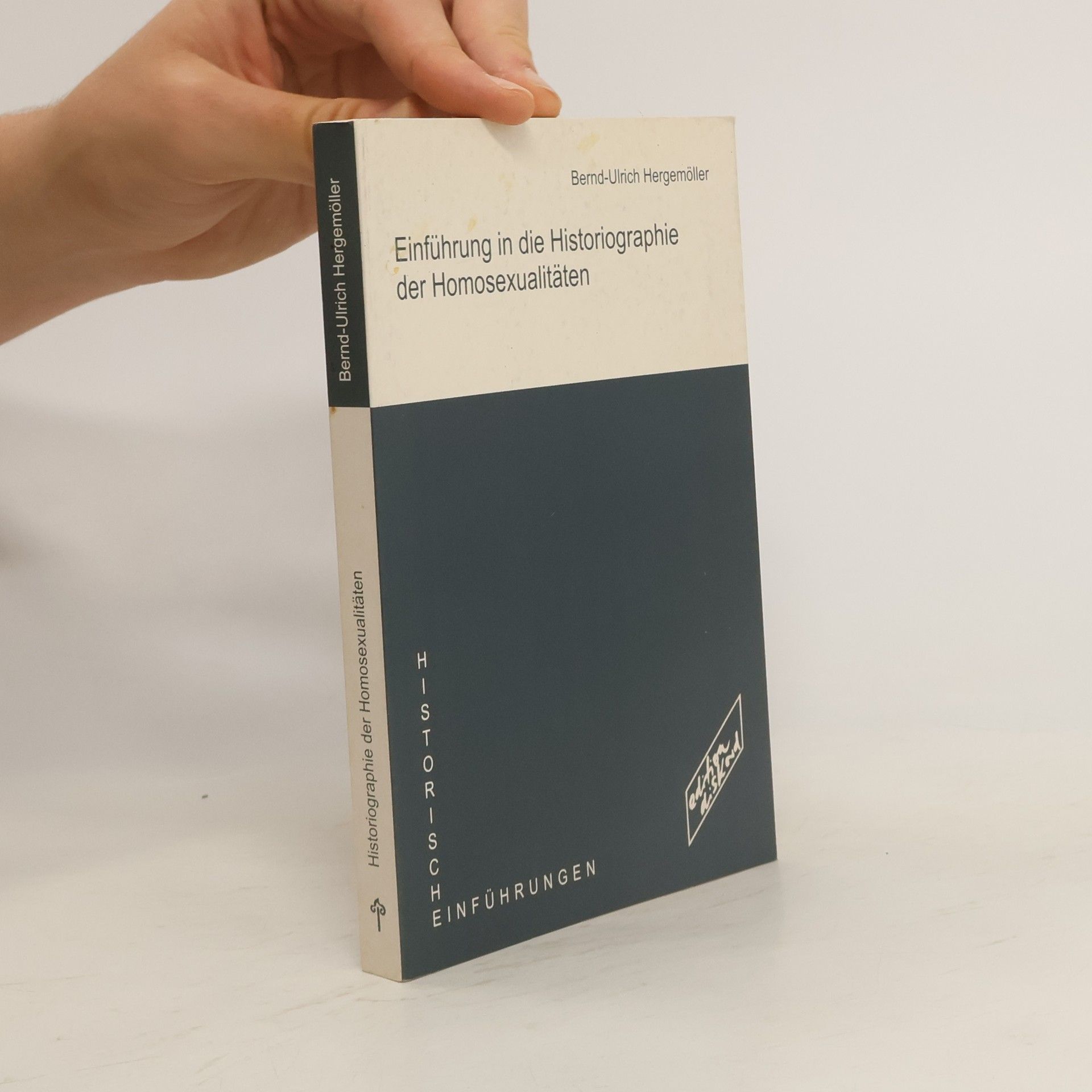
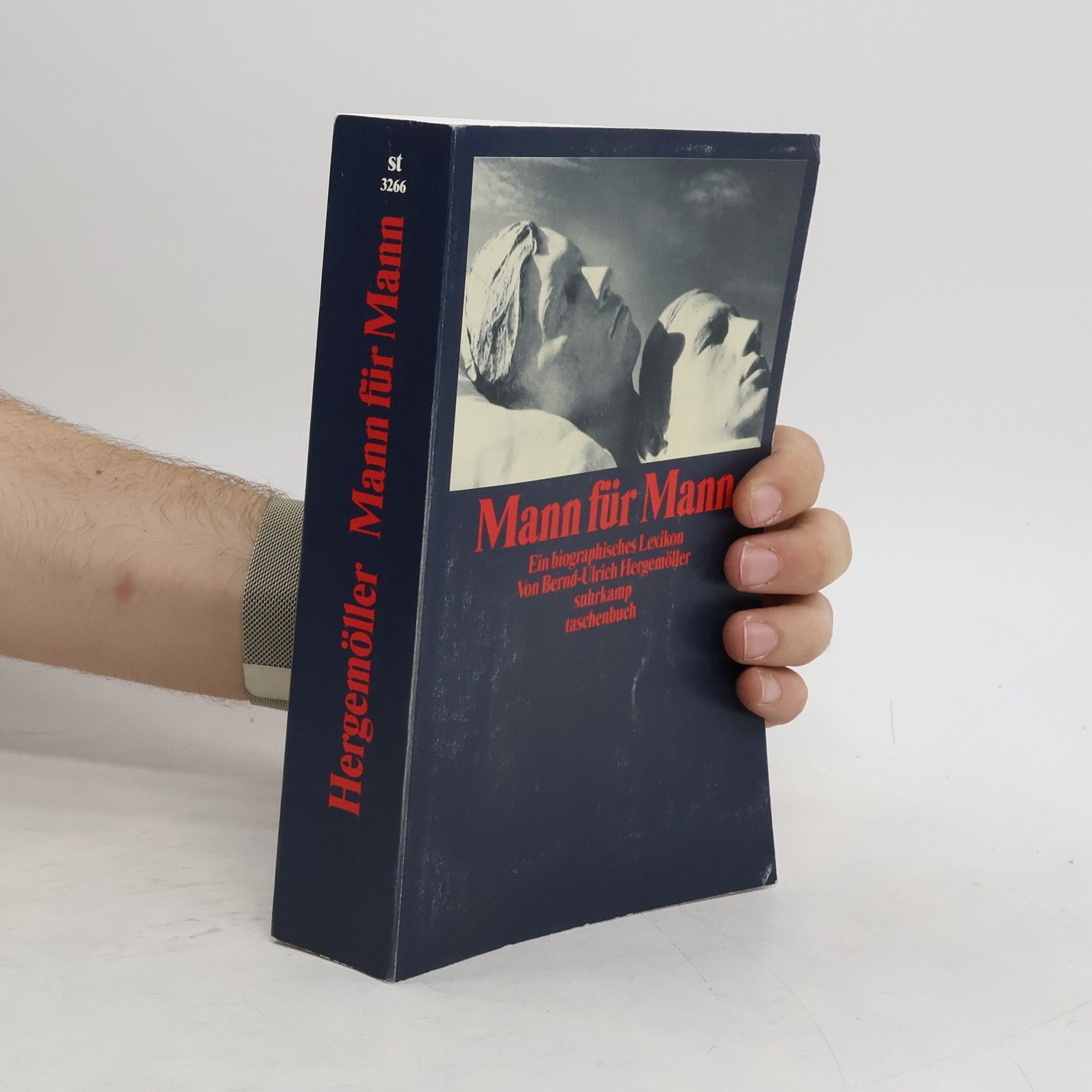
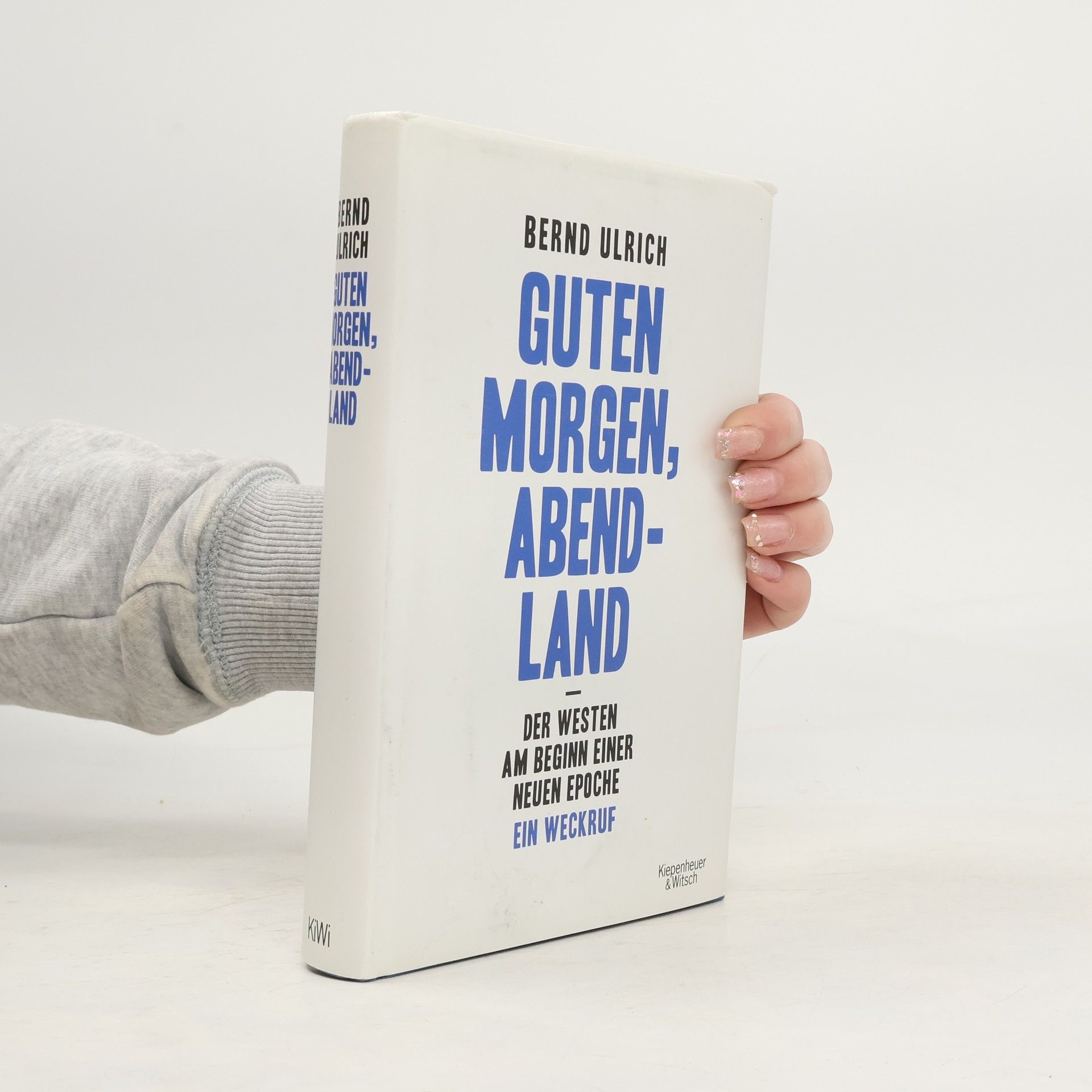
Mann für Mann
- 926 Seiten
- 33 Lesestunden
Alles wird anders
Das Zeitalter der Ökologie
Klimawandel, Artensterben, Ernährung: Sind wir radikal genug? Die ökologischen Widersprüche verschärfen sich, und die politischen Auseinandersetzungen um diese Themen werden intensiver. Ökologie ist nicht länger ein Randthema, sondern rückt ins Zentrum der politischen Diskussion. Der Sommer 2018 hat das Bewusstsein für die schwache ökologische Bilanz der Merkel-Jahre geschärft, was den Grünen zu einem Anstieg ihrer Werte verhalf. Klimapolitisch stehen wir vor entscheidenden Momenten: Verkehrswende, Energiewende, Agrarwende – die notwendigen Eingriffe zur Begrenzung der Erderwärmung sind tiefgreifend und bringen sowohl Verlierer als auch Gewinner mit sich. Diese Veränderungen werfen Fragen auf, die alle anderen Themen, von sozialer Gerechtigkeit bis Demokratie, neu beleuchten. Die politische Kultur ist jedoch nicht auf diese Herausforderungen vorbereitet. Anstatt nach Lösungen für die Probleme zu suchen, wird versucht, die Probleme so zu gestalten, dass sie in die bestehende Politik passen. Diese Verdrängung der ökologischen Herausforderungen neurotisiert unsere Gesellschaft. Der Autor zeigt Wege auf, wie diese Blockade überwunden werden kann, um neue Freiheiten und Zuversicht zu gewinnen.
Sagt uns die Wahrheit!
Was die Politiker verschweigen und warum
Das richtige Buch zur richtigen Zeit. Am 29. April dieses Jahres erschien in der ZEIT ein bemerkenswerter Leitartikel des stellvertretenden Chefredakteurs Bernd Ulrich, der hohe Wellen in der politischen Öffentlichkeit schlug. Sein Text beinhaltete eine grundlegende Kritik an der politischen Klasse der Bundesrepublik, der Bernd Ulrich nicht weniger als eine gefährliche Verdrängung der politischen Wirklichkeit vorwarf. Seine These: »Nie haben sich deutsche Politiker so sehr vor der Wahrheit gedrückt.« Die Wahrheit – das sind die ungelösten Großkrisen unserer Gegenwart, die Ängste erzeugen, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei den Politikern selbst: die Flüchtlingsströme, die Griechenlandkrise, die ungewisse Zukunft des Euro, der Krieg in der Ukraine ... Bernd Ulrich formuliert angesichts dieses Bedrohungsszenarios nachdrücklich die Forderung nach Offenheit und Ehrlichkeit und kritisiert die herrschende Beschwichtigungspolitik, die die Aussicht auf konstruktive Lösungen nicht verbessert, sondern zerstört. Sein selbstkritischer Blick zielt dabei auch auf die Rolle der Medien. Seine nun erweiterte Streitschrift fragt nach den Ursachen dieser öffentlichen Verdrängungen und Verharmlosungen und ist zugleich ein Plädoyer für eine neue politische Kultur der Offenheit und eines furchtlosen Dialogs zwischen Politik und Bevölkerung auf Augenhöhe.
Krieg im Frieden
Die umkämpfte Erinnerung an den Ersten Weltkrieg
German
Bernd Ulrich, geboren 1960, ist stellvertretender Chefredakteur und Leiter der Politikredaktion der Zeit. Er studierte Politikwissenschaften und Philosophie in Marburg. Nach Stationen bei der «Wochenpost» und dem «Tagesspiegel» arbeitete er ab 2003 als stellvertretender Chefredakteur und Leiter des Berliner Büros der «Zeit». Bei Rowohlt erschien 2011 sein Buch «Wofür Deutschland Krieg führen darf. Und muss.»