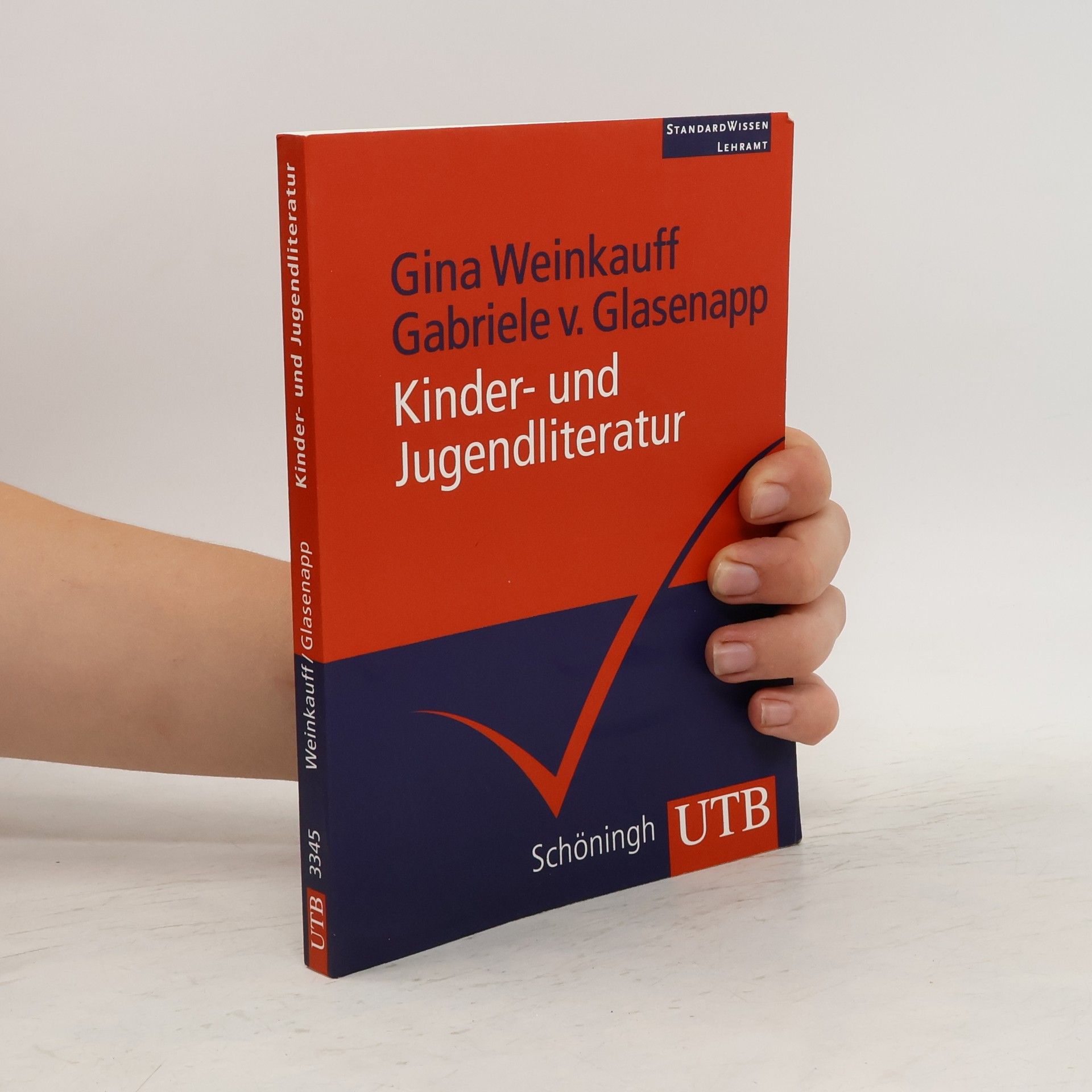Kinder- und Jugendliteratur
- 207 Seiten
- 8 Lesestunden
In allen Schulformen und -stufen ist der Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur im (Deutsch-)Unterricht verbreitete Praxis. Dieses UTB gewährt Einblicke in grundlegende historische und systematische Aspekte des Gegenstandes, die für diese Praxis besonders relevant sind. Nach einem Blick auf die historischen Anfänge treten die heute aktuellen Genres, Formen und Themen in den Vordergrund. Leser bezogene und didaktische Fragen der Kinder- und Jugendliteratur finden in allen Teilen des Buches besondere Berücksichtigung.