Die Anmerkung bietet Interpretationen und Auslegungen zu Thomas Manns Novellen "Tonio Kröger" und "Der Tod in Venedig", einschließlich ihrer Entstehung und Inhalte. Zudem werden didaktische Leitgedanken und Vorschläge für den Unterricht zu beiden Werken präsentiert.
Peter Pfützner Bücher

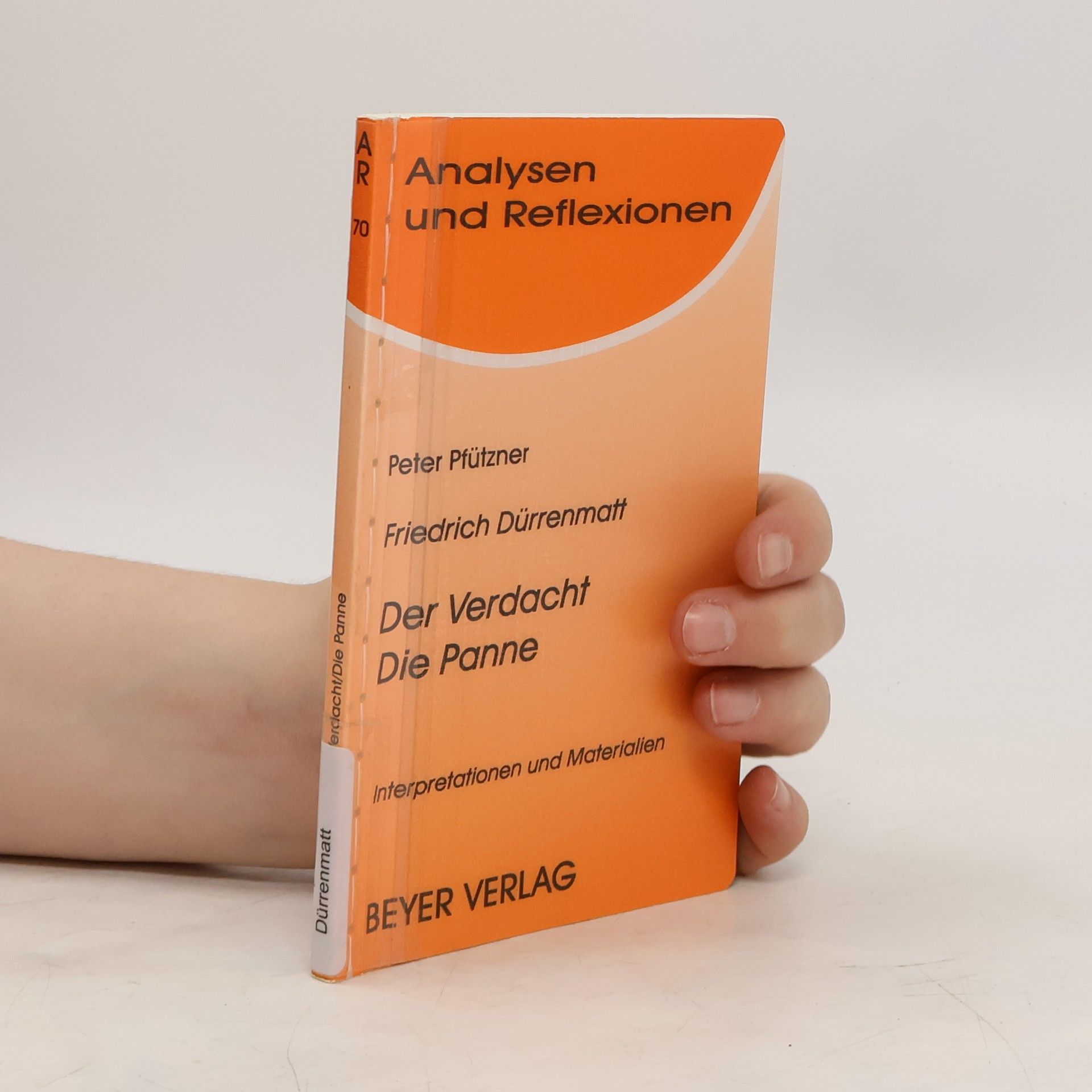
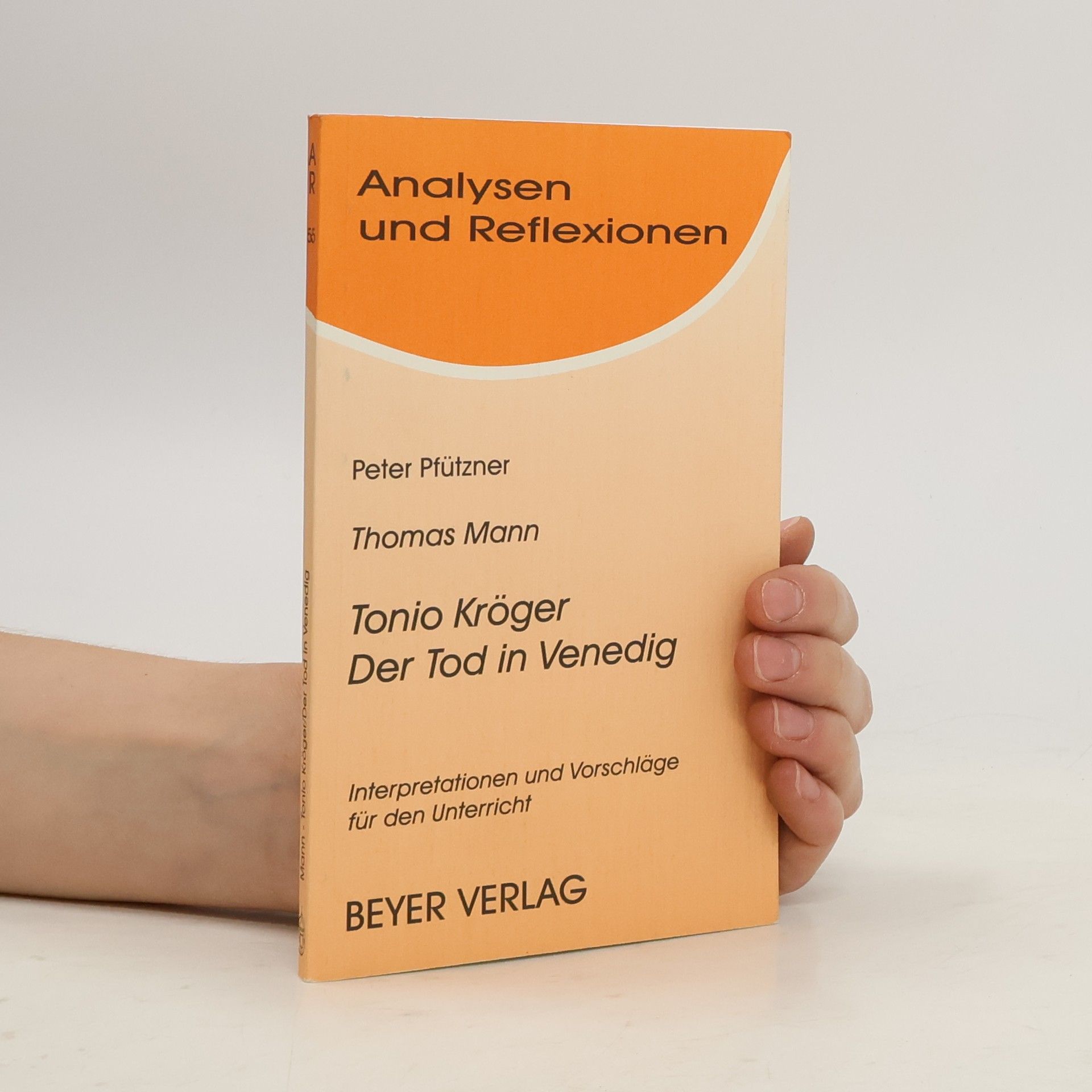
Die Annotation bietet einen Überblick über biografische Aspekte und bibliografische Informationen zu einem Autor, der sich intensiv mit seinem eigenen Werk auseinandersetzt. Er reflektiert über seine Theaterstücke und nutzt Techniken, die an Hitchcock erinnern, um in seinen Erzählungen präsent zu sein. In den ersten beiden Kriminalromanen, „Der Verdacht“ und „Die Panne“, werden zentrale Figuren wie Hans Bärlach und Fritz Emmenberger vorgestellt, während die Erzählung „Die Panne“ sowohl als Novelle als auch als Hörspiel und später als Theaterstück existiert. Der Autor zeigt sich in seinen Werken oft selbstironisch und reflektiert, wobei er seine eigenen Erzählungen nur spärlich kommentiert. Interessant ist, dass die ursprüngliche Idee für „Besuch der alten Dame“ als Erzählung mit einem männlichen Helden begann, während der Kriminalroman „Das Versprechen“ aus einer pädagogischen Filmerzählung hervorging. Der Autor bekennt sich zum Genrewechsel, der ihm einen Erholungseffekt verschafft. Diese Beobachtungen zeigen, wie vielschichtig und dynamisch sein Schaffen ist und wie es sich über verschiedene Medien und Genres entfaltet, während er sich gleichzeitig mit der eigenen Identität als Schriftsteller auseinandersetzt.
Inhalt 1. Biographisches in Stichworten 2. Ausgewählte Angaben zur Bibliographie 3. Dichtart Komödie 4. Anmerkungen zum Thema 'Wirtschaftswunder' 5. Zur Werkgeschichte 6. Die Handlung im Überblick Erster Akt: Szenische Gliederung - Inhalt - Kommentierende Anmerkungen Zweiter Akt: Szenische Gliederung - Inhalt - Kommentierende Anmerkungen Dritter Akt: Szenische Gliederung - Inhalt - Kommentierende Anmerkungen 7. Gegenstände und Probleme 8. Elemente der Dramaturgie 9. Charaktere und Episodenfiguren Die Titelgestalt Der 'Held' Güllens Honoratioren 10. Literaturverzeichnis 11. Die tragische Komödie um Unterricht Anmerkungen und Vorschläge