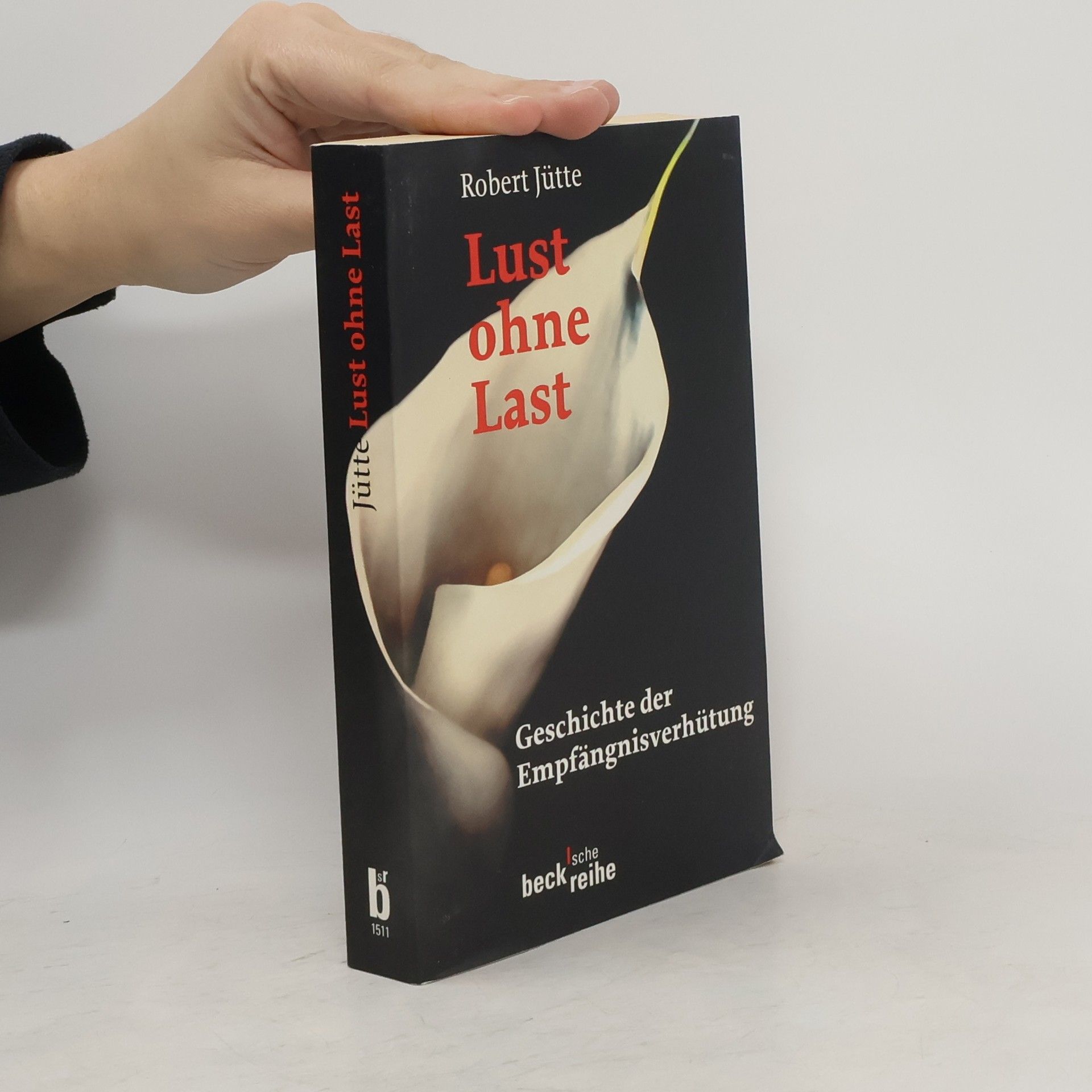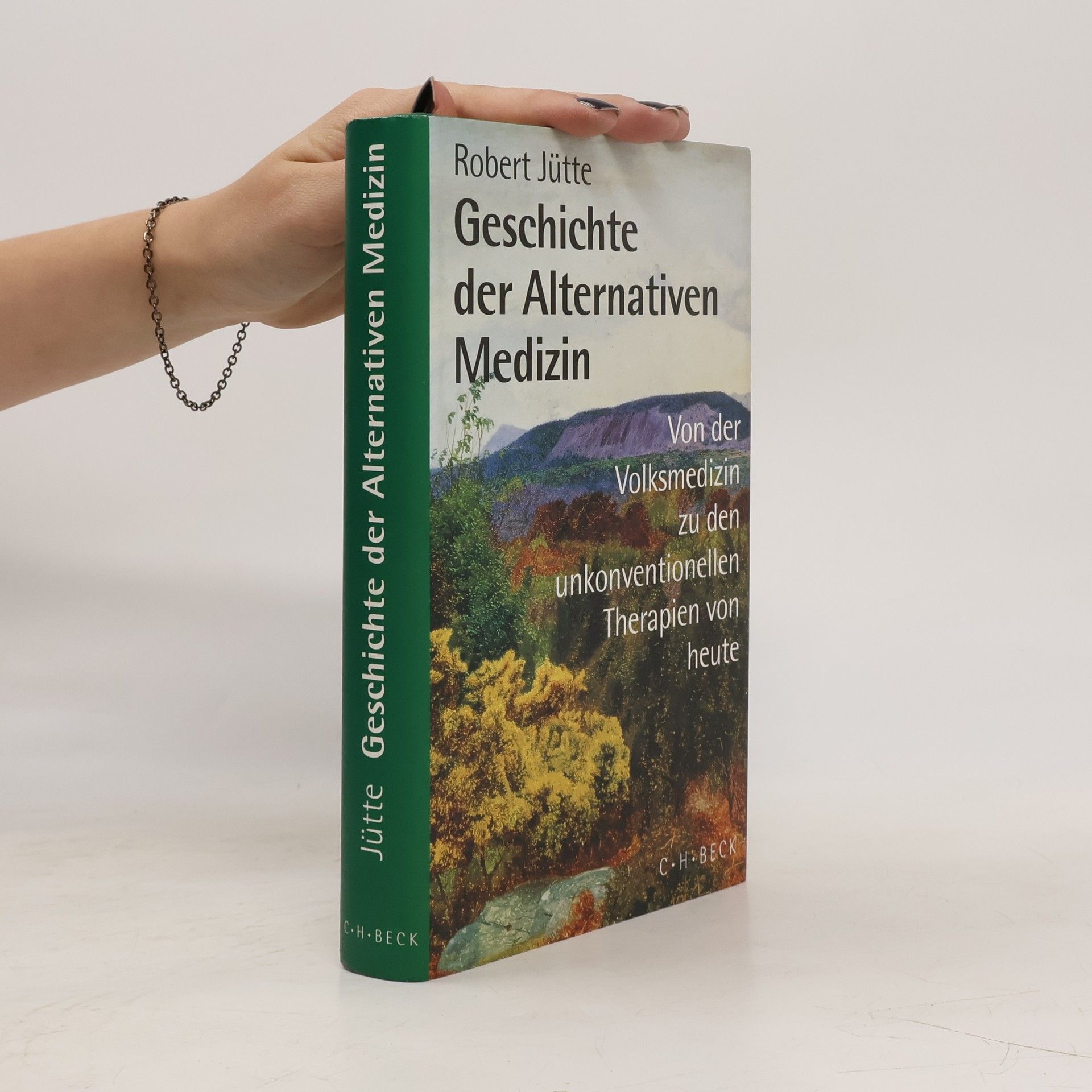Robert Jütte Bücher



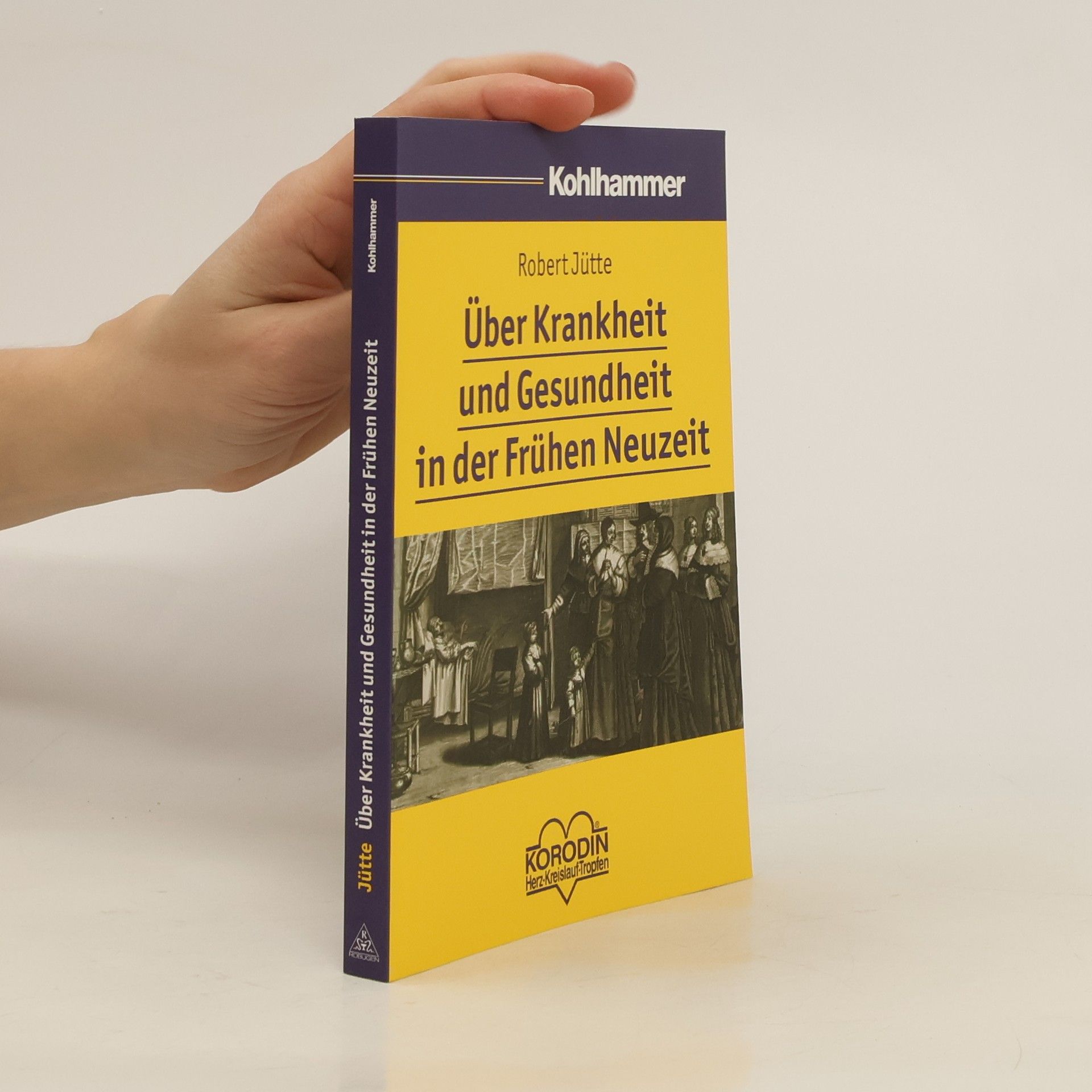


"Besitzvermerke in den wenigen Büchern, die jüdische Emigranten nach 1933 auf der Flucht mitnehmen konnten, liefern Hinweise darauf, wie es ihnen im Exil ergangen ist. Bücher, ob ganze Bibliotheken oder einzelne Bände, die Emigranten oder Opfern der Shoah gehörten, sind 'stumme Überlebende', wie Lucy Dawidowicz es einmal formuliert hat. Sie vermögen bisher unerzählte Geschichten in Erinnerung zu rufen. Die hier getroffene Auswahl aus einer Privatsammlung legt Zeugnis von insgesamt zehn Einzelschicksalen ab, darunter mehrheitlich von Überlebenden, aber auch von einem jungen Berliner Juden, den die Nazis 1942 deportiert und dann in Auschwitz ermordet haben."--Page 4 of cover
Über Krankheit und Gesundheit in der Frühen Neuzeit
- 243 Seiten
- 9 Lesestunden
Mit den Fortschritten in der Medizin, vor allem aber mit der Verbesserung des Lebensstandards schwindet immer mehr das Bewusstsein, dass Krankheiten einst ein "geschichtsmächtiger" Faktor waren. So stellten in der Vergangenheit die ständige Bedrohung durch Seuchen und die hohe Kindersterblichkeit ganz besondere Anforderungen an die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Systeme, aber auch an die Leidensfähigkeit der Menschen. Die Geschichte der Krankheit in der Frühen Neuzeit zeigt, wie sich individuelle und kollektive Strategien von Krankheitsbewältigung herausgebildet haben, die auch heute noch teilweise recht wirkmächtig sind (Stichwort: Quarantäne). Der Blick richtet sich nicht nur auf die verheerenden "Volkskrankheiten" in damaliger Zeit, sondern auch auf chronische Erkrankungen, die typisch für die Frühe Neuzeit sind.
Krankheit und Gesundheit in der Frühen Neuzeit
- 243 Seiten
- 9 Lesestunden
Mit den Fortschritten in der Medizin, vor allem aber mit der Verbesserung des Lebensstandards schwindet immer mehr das Bewusstsein, dass Krankheiten einst ein "geschichtsmächtiger" Faktor waren. So stellten in der Vergangenheit die ständige Bedrohung durch Seuchen und die hohe Kindersterblichkeit ganz besondere Anforderungen an die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Systeme, aber auch an die Leidensfähigkeit der Menschen. Die Geschichte der Krankheit in der Frühen Neuzeit zeigt, wie sich individuelle und kollektive Strategien von Krankheitsbewältigung herausgebildet haben, die auch heute noch teilweise recht wirkmächtig sind (Stichwort: Quarantäne). Der Blick richtet sich nicht nur auf die verheerenden "Volkskrankheiten" in damaliger Zeit, sondern auch auf chronische Erkrankungen, die typisch für die Frühe Neuzeit sind.
Samuel Hahnemann
- 279 Seiten
- 10 Lesestunden
Zum 250. Geburtstag des großen Homöopathen: Ein bewegtes Leben, spannend erzählt, und zugleich ein Einblick in die Grundprinzipien einer weltweit praktizierten Heilmethode. An prominenter Stelle – unweit des Weißen Hauses in Washington – erinnert heute ein imposantes Denkmal an einen der bedeutendsten deutschen Ärzte der Goethezeit: Samuel Hahnemann (1755-1843), Begründer der Homöopathie. Millionen von Menschen in aller Welt vertrauen inzwischen seiner Heilweise. An dem 1790 von ihm entdeckten Ähnlichkeitsprinzip und den Arzneimittelgaben in hohen Verdünnungen scheiden sich immer noch die Geister. Anschaulich schildert Robert Jütte das bewegte Leben Samuel Hahnemanns, von den schwierigen Anfängen als medizinischer Schriftsteller und Übersetzer in der sächsischen Provinz bis zu den Glanztagen als »Modearzt« der Pariser Gesellschaft. Zu seinen Patienten zählten u. a. der Feldmarschall Karl Philipp von Schwarzenberg und der Geiger Niccolò Paganini. Über eine interessante und spannende Biographie hinaus, die sich auf neue Quellen stützt, werden hier nicht nur Einblicke in Grundprinzipien und Praxis der homöopathischen Heilkunst vermittelt. Das Augenmerk richtet sich auch auf das, was Patienten bereits zu Lebzeiten Hahnemanns an der Homöopathie schätzten.
Lust ohne Last
- 368 Seiten
- 13 Lesestunden
Empfängnisverhütung ist keine Erfindung der Neuzeit und auch nie reine Privatsache gewesen. Mächtige Institutionen wie Kirche und Staat machten hier ihren Einfluß ebenso geltend wie bestimmte Berufsgruppen, die für sich besondere Kompetenz in ethischen und sittlichen Fragen beanspruchen. Wie sind unsere Vorfahren mit Empfängnisverhütung umgegangen, und wie haben sich Techniken und Moralvorstellungen, die heute noch aktuell sind, entwickelt? Das Buch verfolgt diese Fragen von der Antike bis zur Gegenwart und wirft darüber hinaus noch einen Blick in die Zukunft. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf dem neuzeitlichen Europa, daneben werden aber auch unterschiedliche Kulturkreise (Europa, Amerika, China, Indien) und Weltreligionen (Christentum, Judentum, Islam) wie auch zentrale demographische und bevölkerungspolitische Aspekte berücksichtigt.
Erstmalig wird die Geschichte der deutschen Ärzteschaft von ihren Anfängen bis zur Gegenwart umfassend und allgemeinverständlich dargestellt. Ärzte haben in den letzten hundert Jahren erfolgreich ihre Interessen in der Gesundheitspolitik vertreten und zugleich öffentliche Aufgaben wahrgenommen. Der Professionalisierungsprozess, in dem ärztliche Berufsorganisationen eine zentrale Rolle spielen, wird detailliert beleuchtet. Der historische Bogen reicht von den gelehrten Ärztevereinen der Biedermeier-Zeit bis zum 100. Deutschen Ärztetag 1997 in Eisenach. Wichtige Themen sind die Reformbestrebungen der demokratischen Ärzte von 1848/49, die Gründung des Deutschen Ärztevereinsbundes 1873 sowie die sozialpolitischen Kämpfe im Kaiserreich und der Weimarer Republik. Auch das Versagen der Ärzteschaft im Dritten Reich und ihre Rolle in West- und Ostdeutschland nach dem Krieg werden behandelt. Gesundheitspolitisch Interessierte finden hier eine differenzierte Analyse einer Berufsgruppe, die wegen ihres gesellschaftlichen Einflusses besonders zur Rechenschaft verpflichtet ist. Das Buch ist wissenschaftlich fundiert, gut lesbar und bietet eine Vielzahl an Fotografien, Dokumenten und Grafiken, die den Text bereichern. Es ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für jeden Arzt, der sich für Berufspolitik interessiert.
Geschichte der alternativen Medizin
- 341 Seiten
- 12 Lesestunden
Geschichte der Abtreibung
- 219 Seiten
- 8 Lesestunden