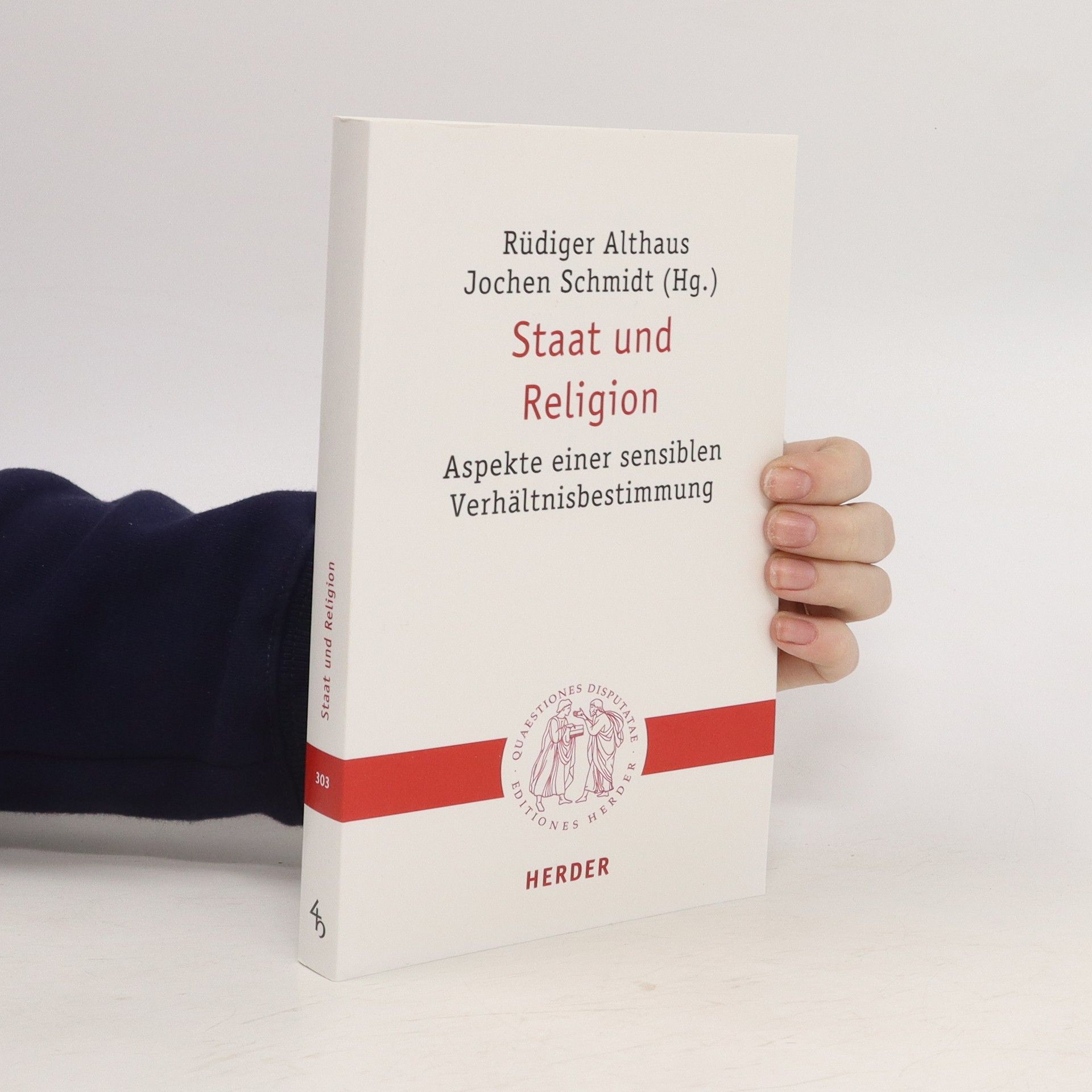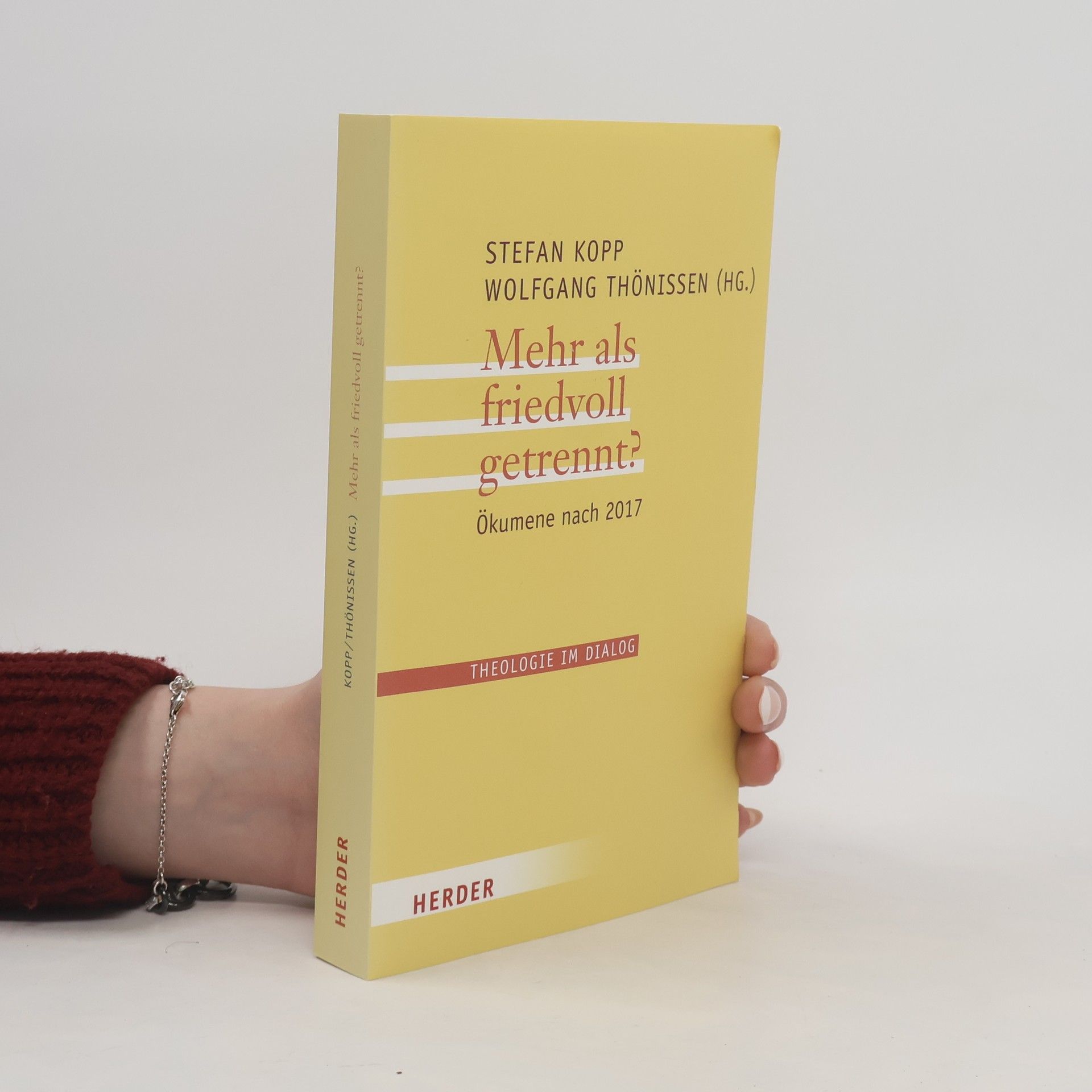Die kirchliche Trauung - Ehevorbereitung, Trauung und Registrierung der Eheschließung im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz
Texte und Kommentar
- 200 Seiten
- 7 Lesestunden
Die Vorbereitung eines Brautpaares auf die kirchliche Trauung erfordert nicht nur seelsorglich-geistlich besondere Sorgfalt, sondern auch administrative Genauigkeit, damit in Anbetracht der Vielfalt der Lebenswirklichkeit einer gültigen oder erlaubten Eheschließung nichts im Wege steht. Dabei sind die einschlägigen Vorschriften des gesamtkirchlichen Rechts zu beachten, aber auch Partikularnormen bzw. Generaldekrete der Bischofskonferenzen zur Ehevorbereitung, Trauung und Registrierung der Eheschließung. Das vorliegende Buch stellt anhand des aktuellen Ehevorbereitungsprotokolls und der weiteren amtlichen Vordrucke der Deutschen Bischofskonferenz detailliert die zu beachtenden Regelungen vor und geht auf die unterschiedlichen Fallkonstellationen ein. So bietet diese der geltenden Rechtslage angepasste Neuauflage der bewährten Handreichung Seelsorgern, Studierenden und allen, die mit der kirchlichen Ehevorbereitung zu tun haben, umfassende Informationen zu allen praxisrelevanten Fragen der kirchlichen Trauung.