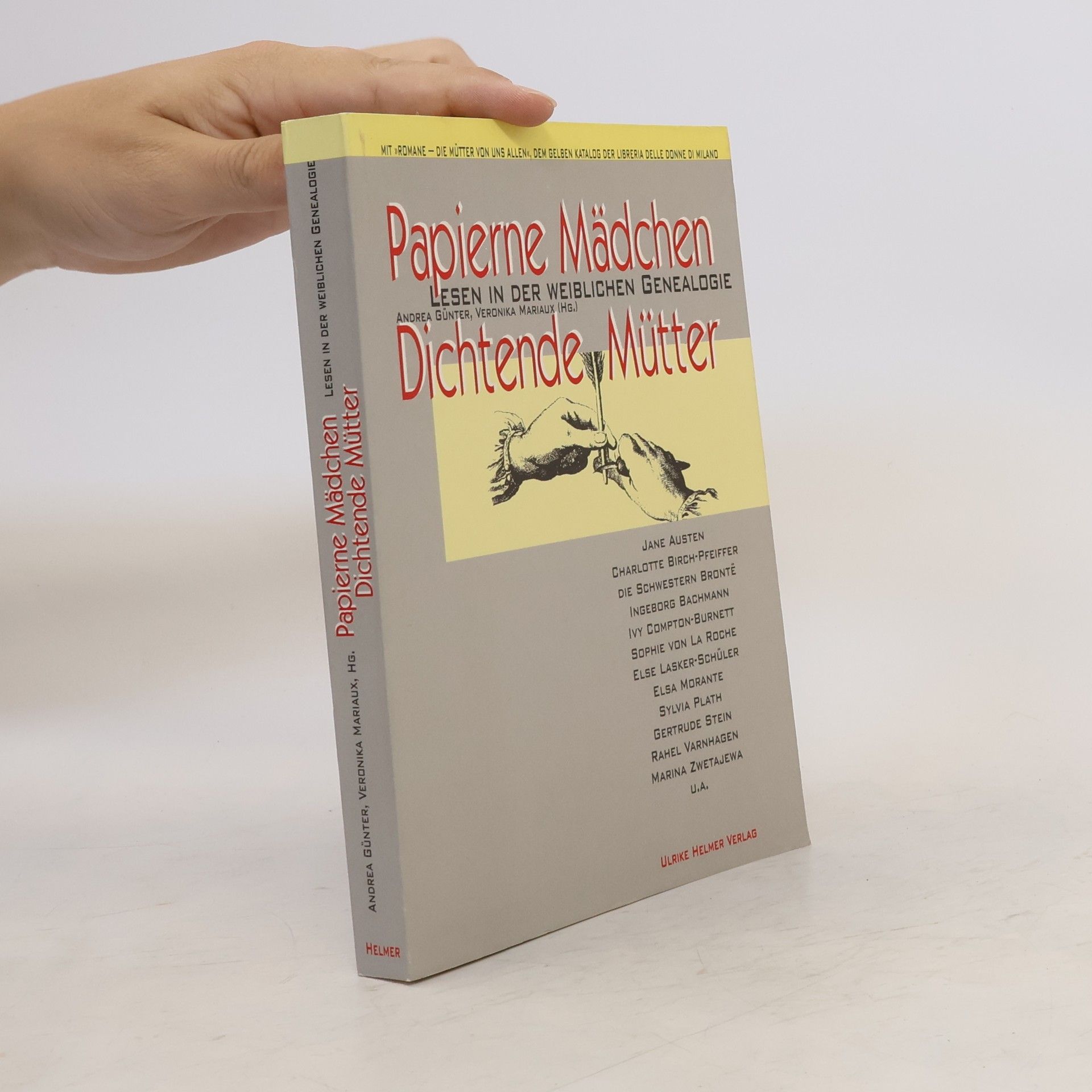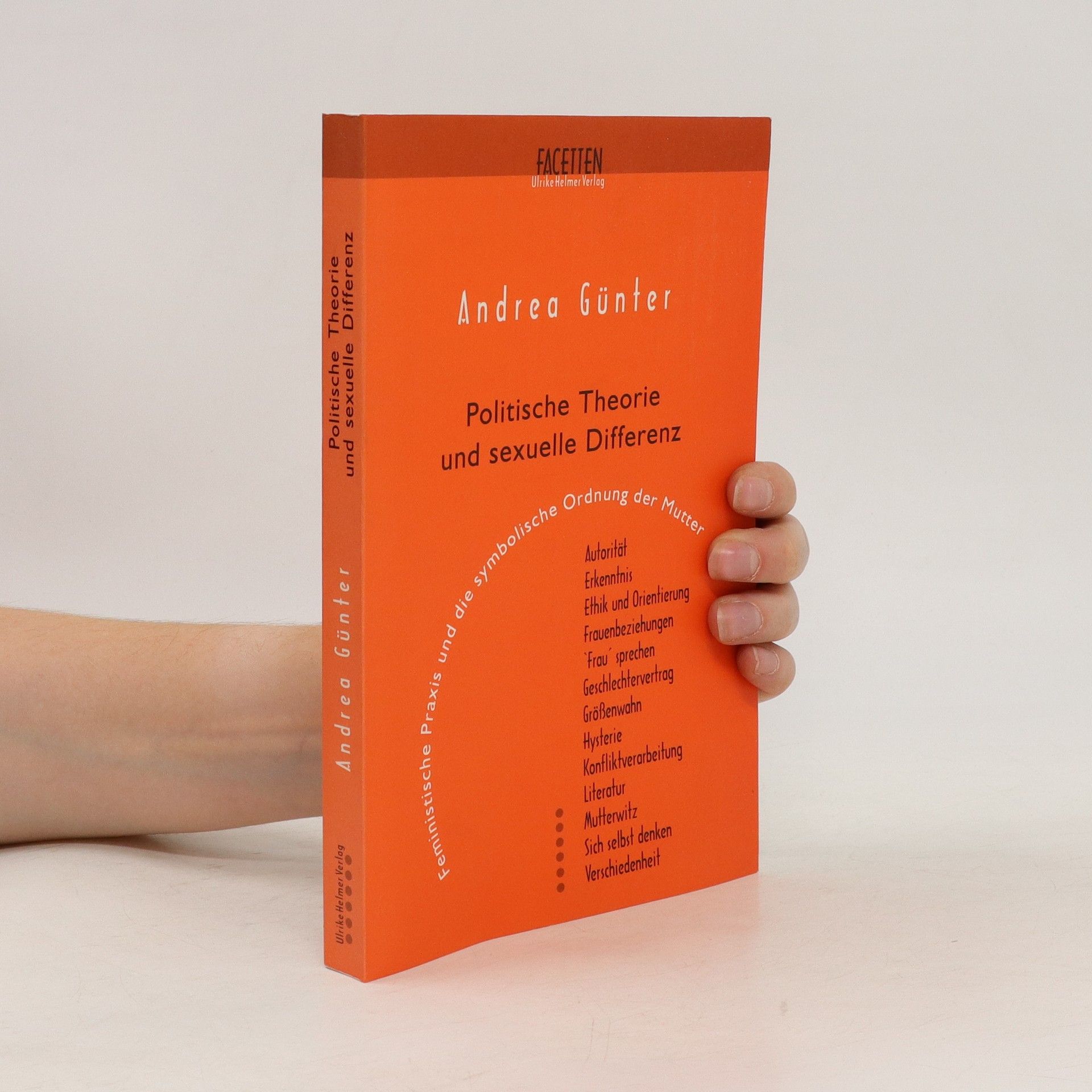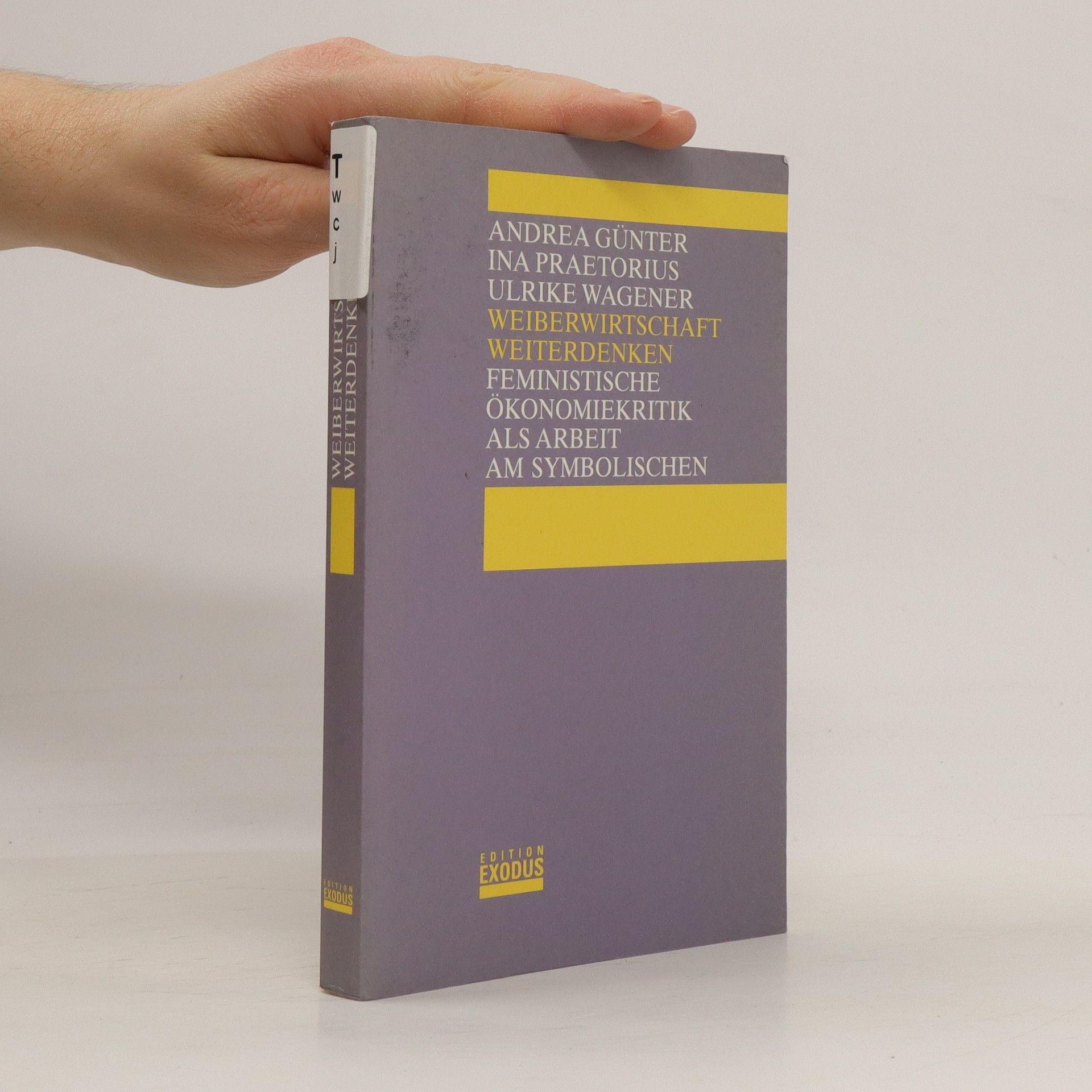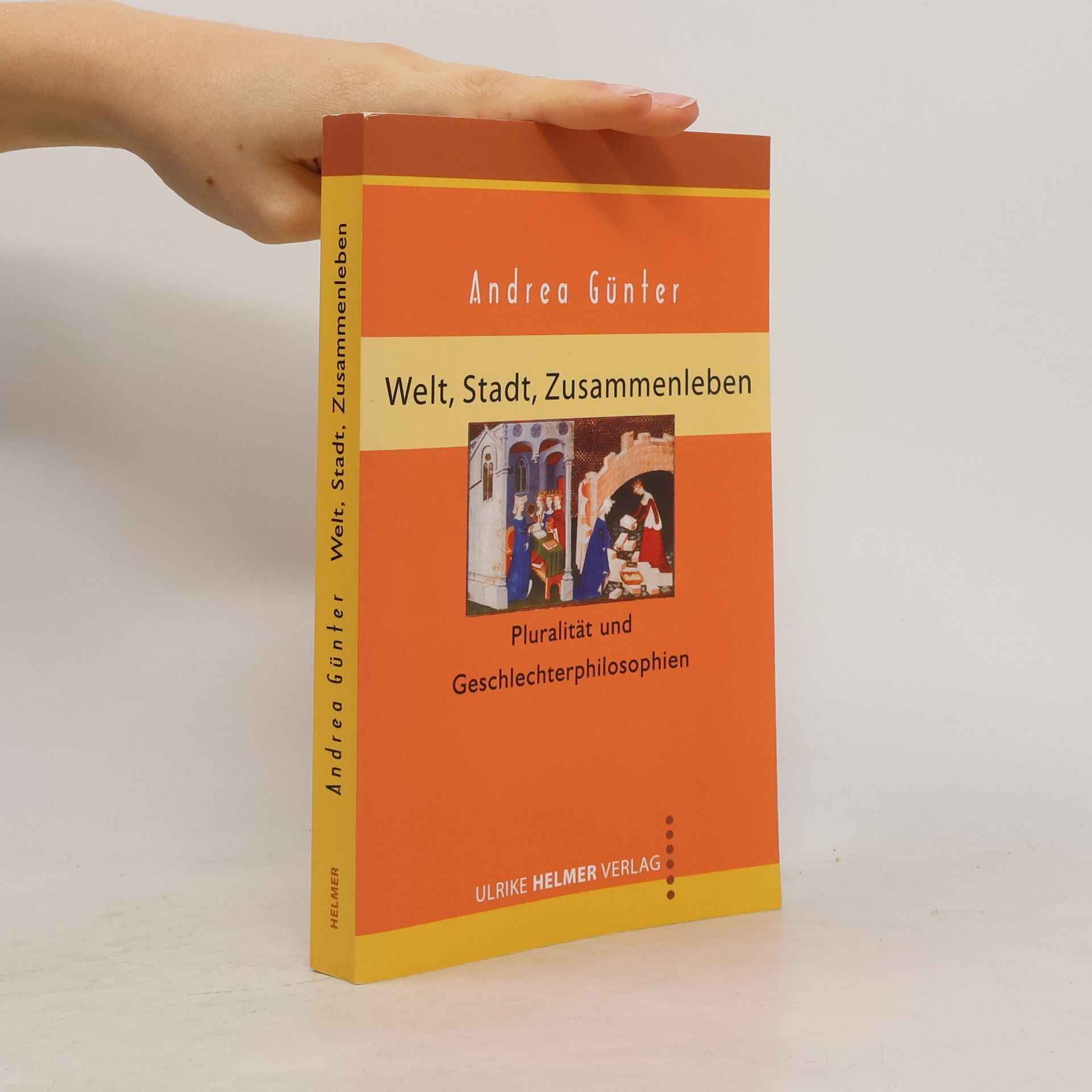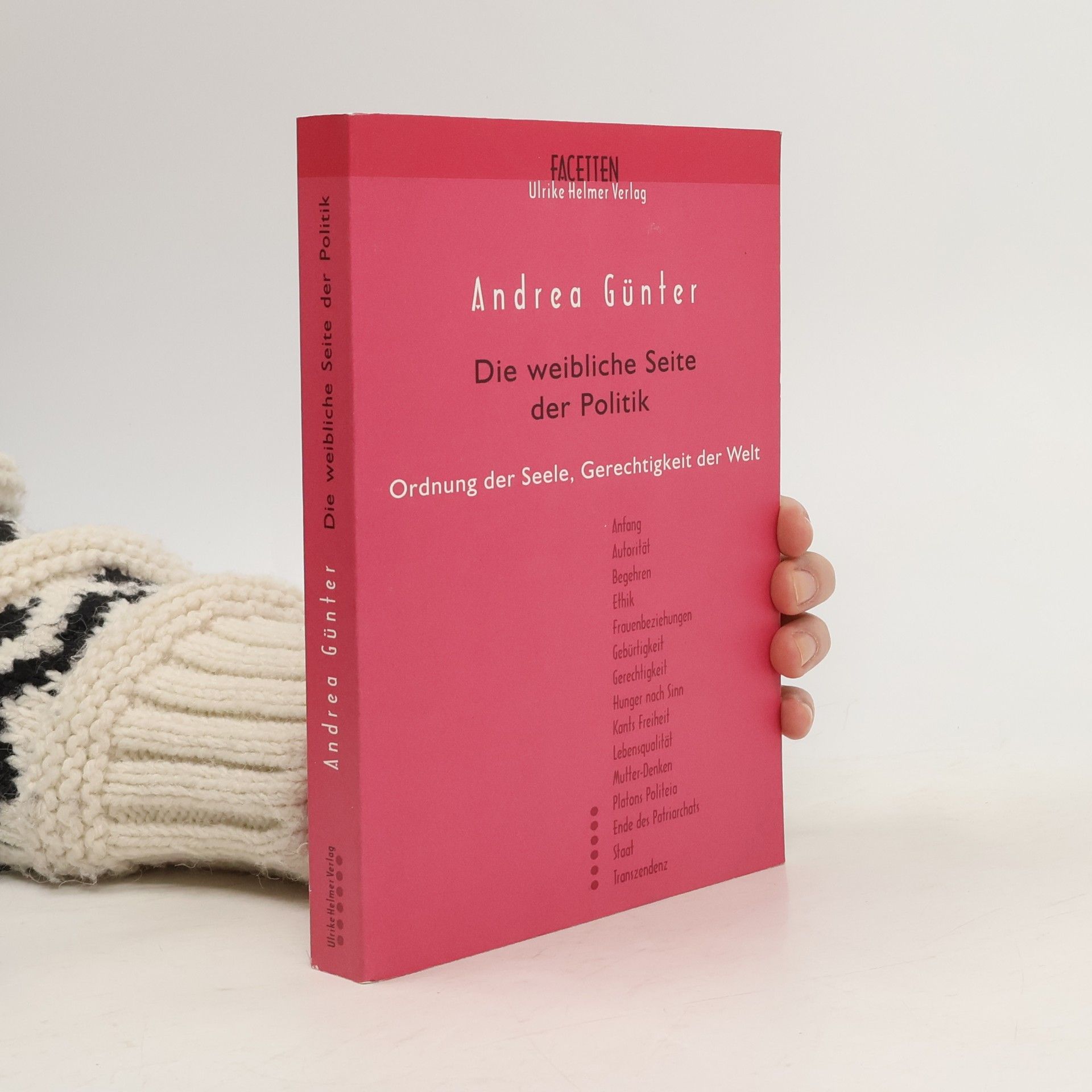Gerechtigkeit und die Ökologie des Ökonomischen
Ökofeminismus, Klimaethik, Feministische Geldtheorie
Frauen sind besonders vom Klimawandel betroffen: Die durch die Veränderungen ausgelösten Krisen drängen sie in überkommene Geschlechterverhältnisse. Darum muss Klimapolitik nicht nur eine Neukonzeption des Ökonomischen vorantreiben, sondern auch mit einer Patriarchatskritik einhergehen, die bis in die Konzepte von Gerechtigkeit hineinwirkt. Wenn nachhaltige ökonomische Konzepte entwickelt werden sollen, müssen sie die Kategorie Geschlecht berücksichtigen und Klimaverhältnisse gendersensibel analysieren. Für eine neue Sichtweise werden Ariel Sallehs Konzept des Ökofeminismus und Hannah Arendts Vita activa herangezogen. Die Güter- und Tugendethik wird klimaethisch aktualisiert und eine Feministische Geldtheorie erörtert.