Der Bildungsstreik und die Hörsaalbesetzungen im Jahr 2009 haben gezeigt, daß der Widerstand gegen Studiengebühren und die Bologna-Reform sich immer weiter aufheizt. Die Studierenden klagen über zunehmenden Streß, maßgebliche Ziele der Reform wurden verfehlt. Richard Münch, einer der renommiertesten Kritiker dieser Entwicklung, untersucht in seiner brisanten neuen Studie die Kräfte hinter dem neuen akademischen Kapitalismus. Er legt dar, wie sich die Hochschulen unter dem Einfluß von Beratungsfirmen in Unternehmen verwandeln und wie kurzfristige Nutzenerwartungen das Innovationspotential der Forschung untergraben.
Richard Münch Bücher
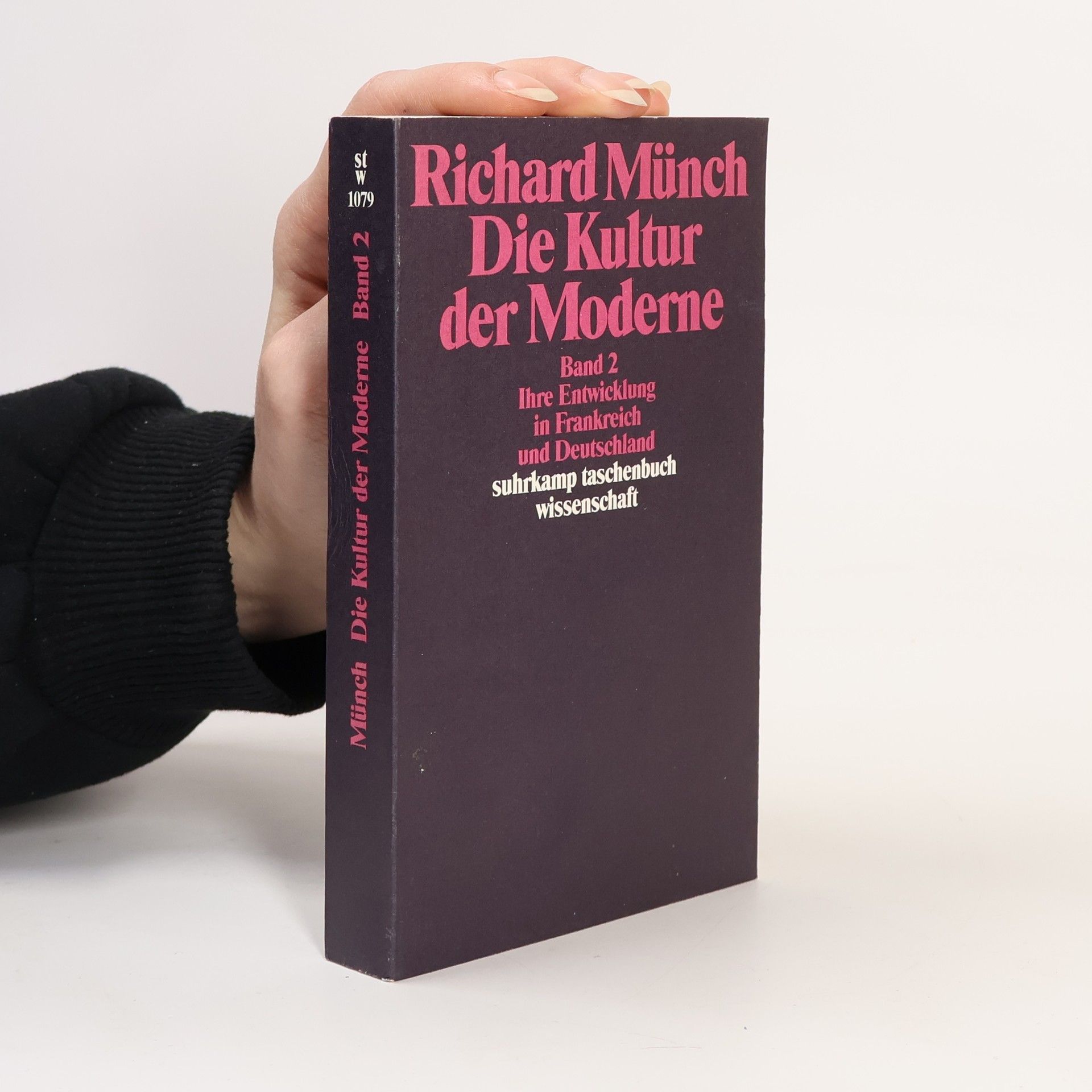
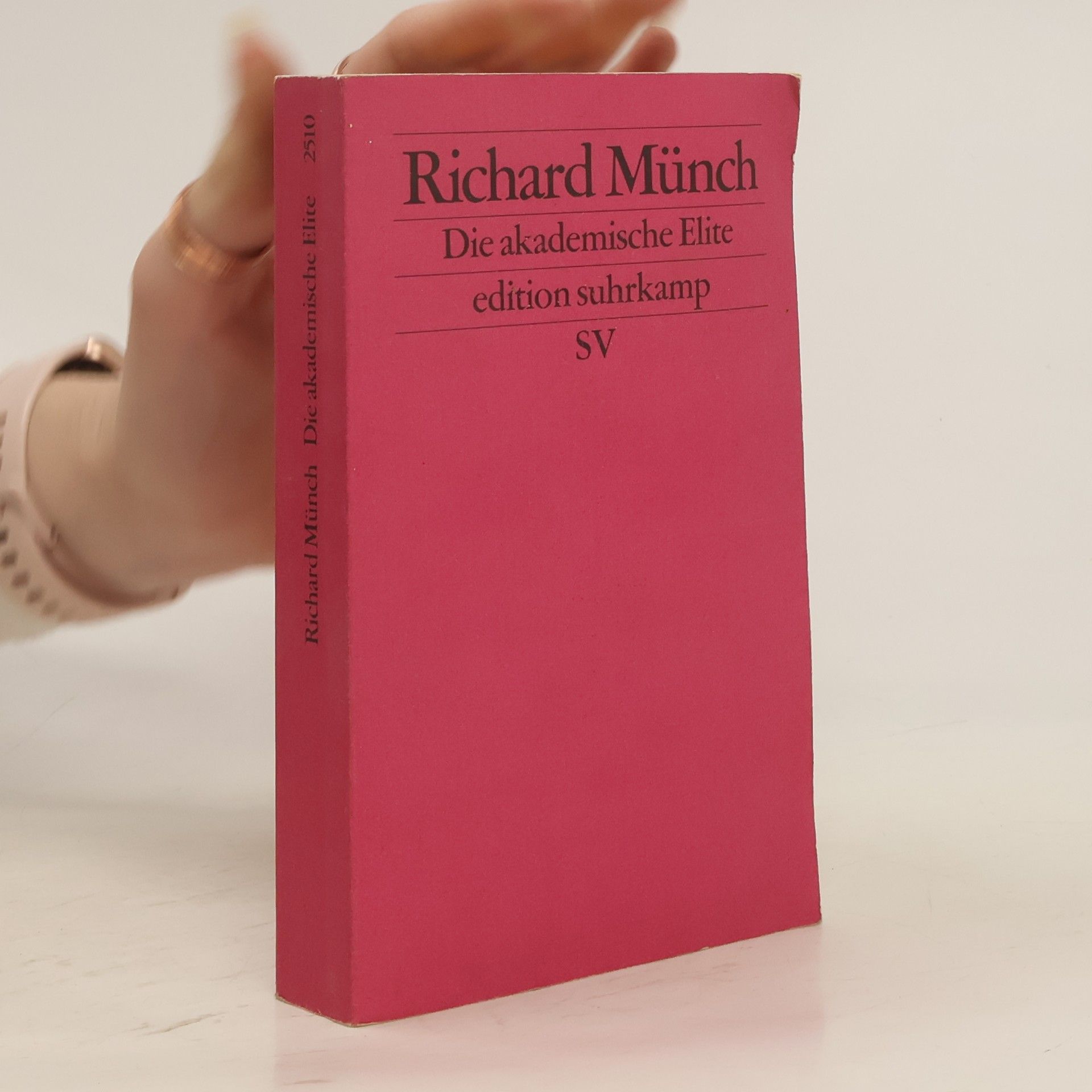


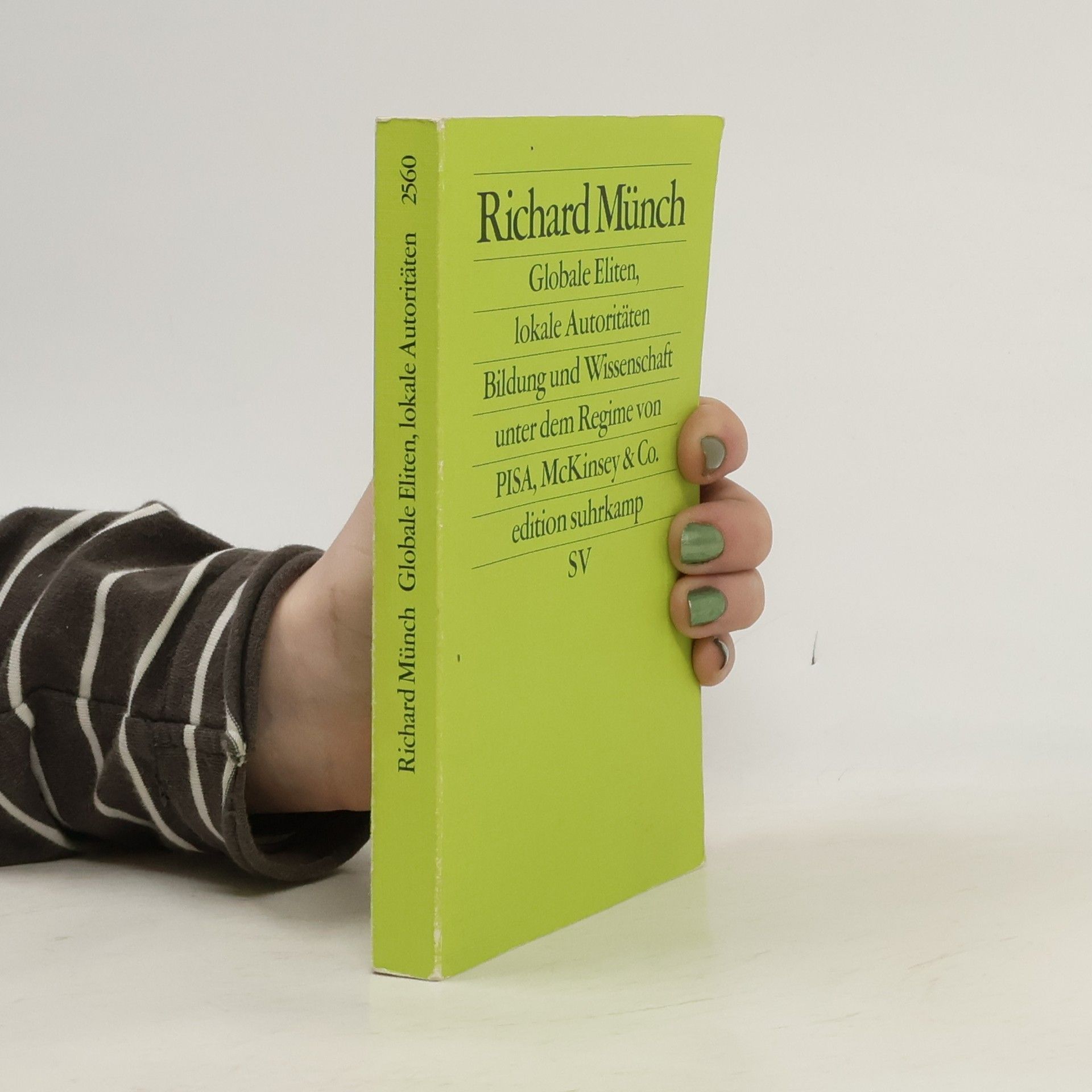

Globale Eliten, lokale Autoritäten
Bildung und Wissenschaft unter dem Regime von PISA, McKinsey & Co.
- 266 Seiten
- 10 Lesestunden
Ob es um Lehrpläne für Gymnasien geht oder um die Privatisierung öffentlicher Leistungen: Überall auf der Welt sind lokale Autoritäten wie Kommunalpolitiker oder Lehrer mit standardisierten, angeblich wissenschaftlichen Rezepten konfrontiert. Vorgegeben werden sie von einer globalen Beraterelite. Mit den Problemen, die entstehen, wenn auf dem Land die Müllabfuhr privatisiert oder generell Bildung auf die Bereitstellung von Humankapital reduziert wird, müssen die Verantwortlichen jedoch alleine zurechtkommen. Richard Münch, einer der international renommiertesten deutschen Soziologen, untersucht die Mechanismen hinter der globalen Standardisierung lokaler Lebenswelten.
Globale Dynamik, lokale Lebenswelten
Der schwierige Weg in die Weltgesellschaft
- 458 Seiten
- 17 Lesestunden
Nach der Ersten Moderne des ökonomischen Liberalismus und des liberalen Rechtsstaates und der Zweiten Moderne der Wohlfahrtsökonomie und des demokratischen Rechtsstaates stehen wir jetzt an der Schwelle einer Dritten Moderne. Ob sie die Modernisierungsrisiken der Ersten und Zweiten Moderne besser bewältigen und gleichwohl ihre Errungenschaften bewahren kann, ist noch völlig offen. Die Dritte Moderne wird zunächst von einer Verschärfung ökologischer Risiken und von neuen sozialen Eruptionen geprägt sein. Ihre Bewältigung im Rahmen einer erst noch aufzubauenden globalen Mehr-Ebenen-Demokratie kann keineswegs als sicher gelten. Es handelt sich dabei um nicht mehr als ein Programm, dessen Verwirklichung sich in der Dritten Moderne nicht von allein einstellt.
Die Struktur der Moderne
Grundmuster und differentielle Gestaltung des institutionellen Aufbaus der modernen Gesellschaften
- 762 Seiten
- 27 Lesestunden
Die Moderne verstehen – dies ist ein prominentes Thema der Soziologie. Richard Münch versucht in seinem neuen Buch, durch die soziologische Analyse ihres institutionellen Aufbaus zu einem Verständnis der Grundstruktur und der Strukturprobleme der modernen Gesellschaften zu gelangen. Im Vordergrund der Analyse steht zunächst die gemeinsame institutionelle Tiefenstruktur moderner Gesellschaften. Diese generalisierende Betrachtung wird dann durch die Analyse ihrer unterschiedlichen institutionellen Oberflächenstruktur im inter- und intrakulturellen Vergleich konkretisiert.
Als im Oktober 2006 die Eliteuniversitäten in München und Karlsruhe gekürt wurden, sagte Annette Schavan, Deutschland könne nun mithalten im internationalen Wettbewerb. Doch wer entscheidet überhaupt darüber, wer sich zur Elite zählen darf? Ist die Errichtung universitärer »Leuchttürme« ein wirksames Mittel gegen die Hochschulmisere? Diesen Fragen widmet Richard Münch seine brisante Studie. Das Ergebnis: Viele Reformen sind kontraproduktiv, sie führen zu einer Verringerung der theoretischen Vielfalt. »Eine Forschungspolitik, die solche Strukturen stärkt, ist nicht auf der Höhe der Zeit und verpaßt die dynamisch voranschreitende internationale Entwicklung.«
Die Herrschaft der Inzidenzen und Evidenzen
Regieren in den Fallstricken des Szientismus
- 220 Seiten
- 8 Lesestunden
»Evidenzbasiertes« Regieren anhand von Statistiken ist schon immer ein Kennzeichen des modernen Staates. Der politisch-administrative Umgang mit der Corona-Pandemie, der von Inzidenzwerten des Infektionsgeschehens bestimmt ist, und zuvor schon die »datengetriebene« Bildungspolitik, insbesondere seit Einrichtung des Programme for International Student Assessment (PISA) der OECD im Jahr 2000, haben diese Praxis auf ein neues Niveau gehoben. Richard Münch zeigt, inwieweit diese Art des Regierens die Wissenschaft für die eigenen Legitimationszwecke instrumentalisiert, wie sie zu einer politisch-administrativen Kontrolle über alle Sektoren der Gesellschaft führt und wie sie sich in den Fallstricken des Szientismus verfängt. Zahlen und Modellrechnungen erzeugen - so die These - einen Schematismus des Entscheidens, der die Komplexität der konkreten Wirklichkeit verfehlt, sodass die gesetzten Ziele nicht erreicht werden und unerwünschte Nebenfolgen auftreten
Polarisierte Gesellschaft
Die postmodernen Kämpfe um Identität und Teilhabe
Die moderne Massenwohlstandsgesellschaft wird zunehmend von einer postmodernen, in Klassen und Identitätsgruppen gespaltenen Gesellschaft abgelöst. Konflikte um die Anerkennung von Identitäten und kulturellen Traditionen sowie um die Teilhabe an Wohlstand, Macht und Prestige verschärfen sich massiv. Richard Münch untersucht in diesem Buch die vielfältigen Spaltungslinien dieser Gesellschaft; die Untersuchung mündet in die Frage, wodurch sie überhaupt noch zusammengehalten werden kann. Seit langem lautet parteienübergreifend die Antwort: Bessere Bildung für alle! Aber was wurde auf diesem Weg bisher erreicht? Die Beantwortung dieser Frage ist Gegenstand der abschließenden Analyse dieses Buches.
„Bildung“ ist das Mantra der „Wissensgesellschaft“ unserer Gegenwart. Durch bessere Bildung sollen die großen Probleme unserer Zeit gelöst werden. Die Schule soll alle aus wachsender Heterogenität folgenden Verwerfungen, Ungleichheiten und Konflikte der Gesellschaft auflösen. Das ist die zentrale Agenda der Ablösung des Wohlfahrtsstaates durch den Wettbewerbsstaat. Richard Münch unterzieht diese Reformagenda einer kritischen Analyse mit Fokus auf der Pionierrolle der USA. Im Mittelpunkt steht dabei die Ablösung des pädagogischen Establishments in den Schaltzentralen der Kultusbürokratie durch einen bildungsindustriellen Komplex, in dem internationale Organisationen, Think Tanks, Beratungsunternehmen, missionarische Milliardärsstiftungen, Bildungsreformer und Bildungsforscher mit der Bildungs- und Testindustrie zusammenwirken, um den schulischen Bildungsprozess einer minutiösen externen Kontrolle zu unterwerfen.
Internationale Arbeitsteilung und grenzüberschreitende Mobilität, transnationale Netzwerke und globale Diskurse haben bisherige Unterscheidungen zwischen dem Eigenen und dem Fremden aufgehoben. Das Credo des liberalen Pluralismus lautet: Anerkennung des Anderen und dessen Gleichstellung mit dem Eigenen. Richard Münch beleuchtet diese kosmopolitische Ethik und zeigt, dass sie vor allem von der transnational vernetzten Elite repräsentiert und gelebt wird, nicht aber vom Großteil der Gesellschaft. Der fortschreitende Pluralismus führt daher zu einem wachsenden Konflikt. Richard Münch untersucht diesen Konflikt in seiner historischen Entwicklung, seiner unterschiedlichen gesellschaftlichen Institutionalisierung und seinen europäischen sowie globalen Dimensionen.